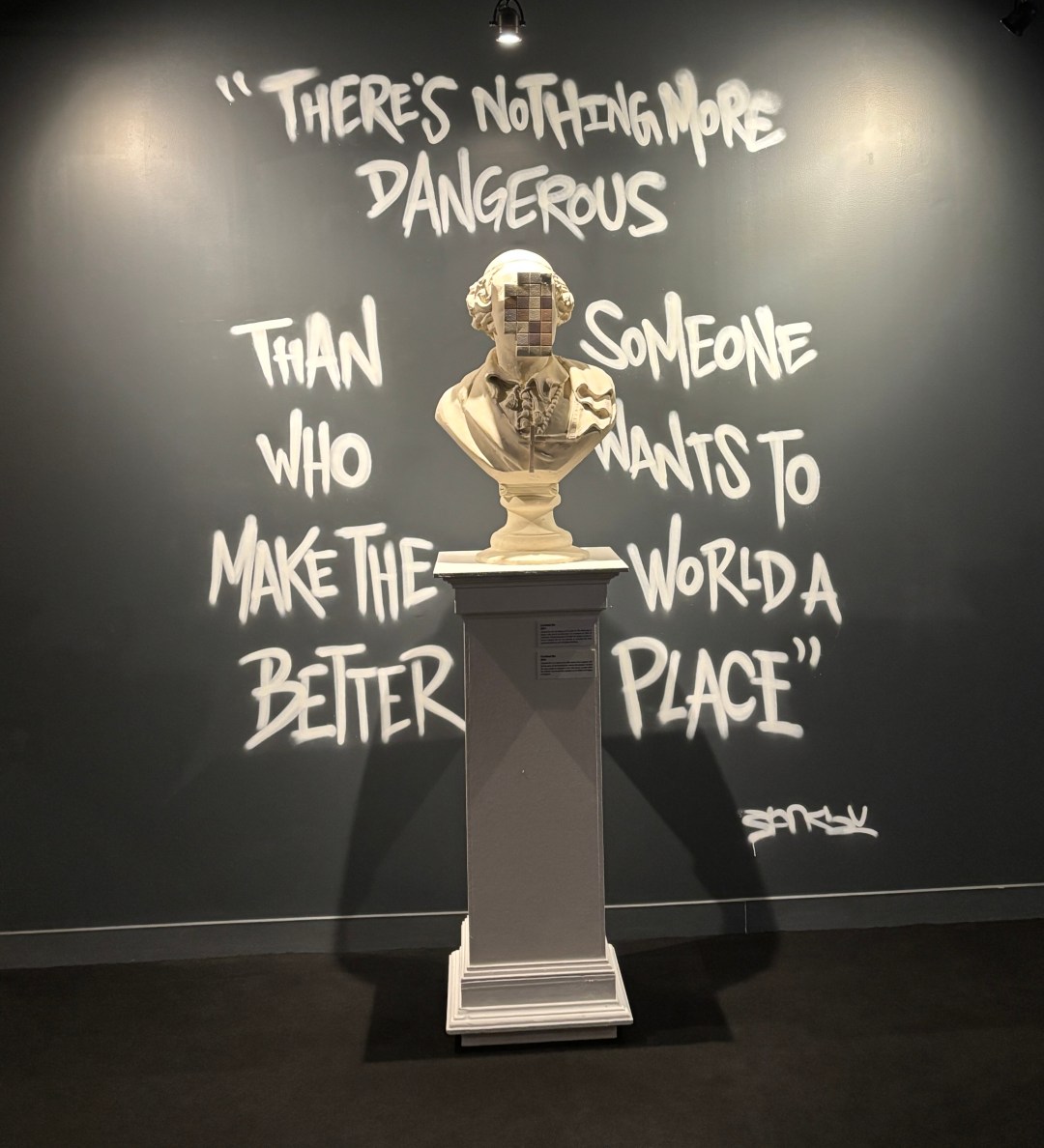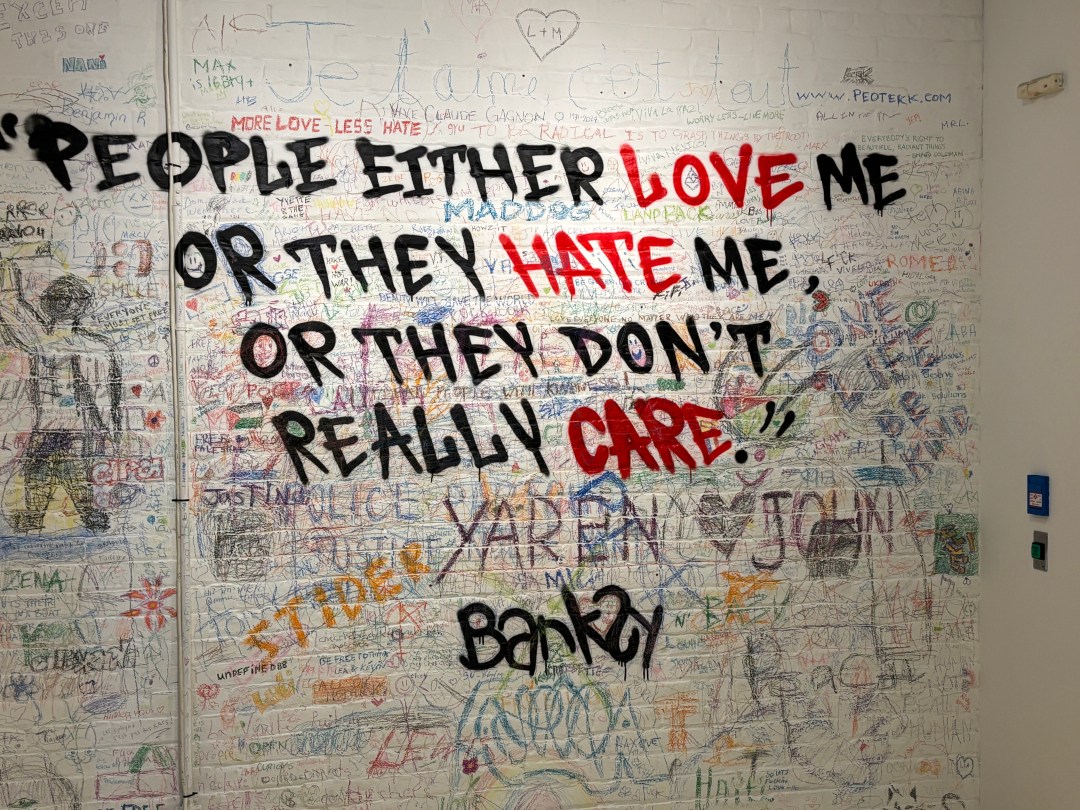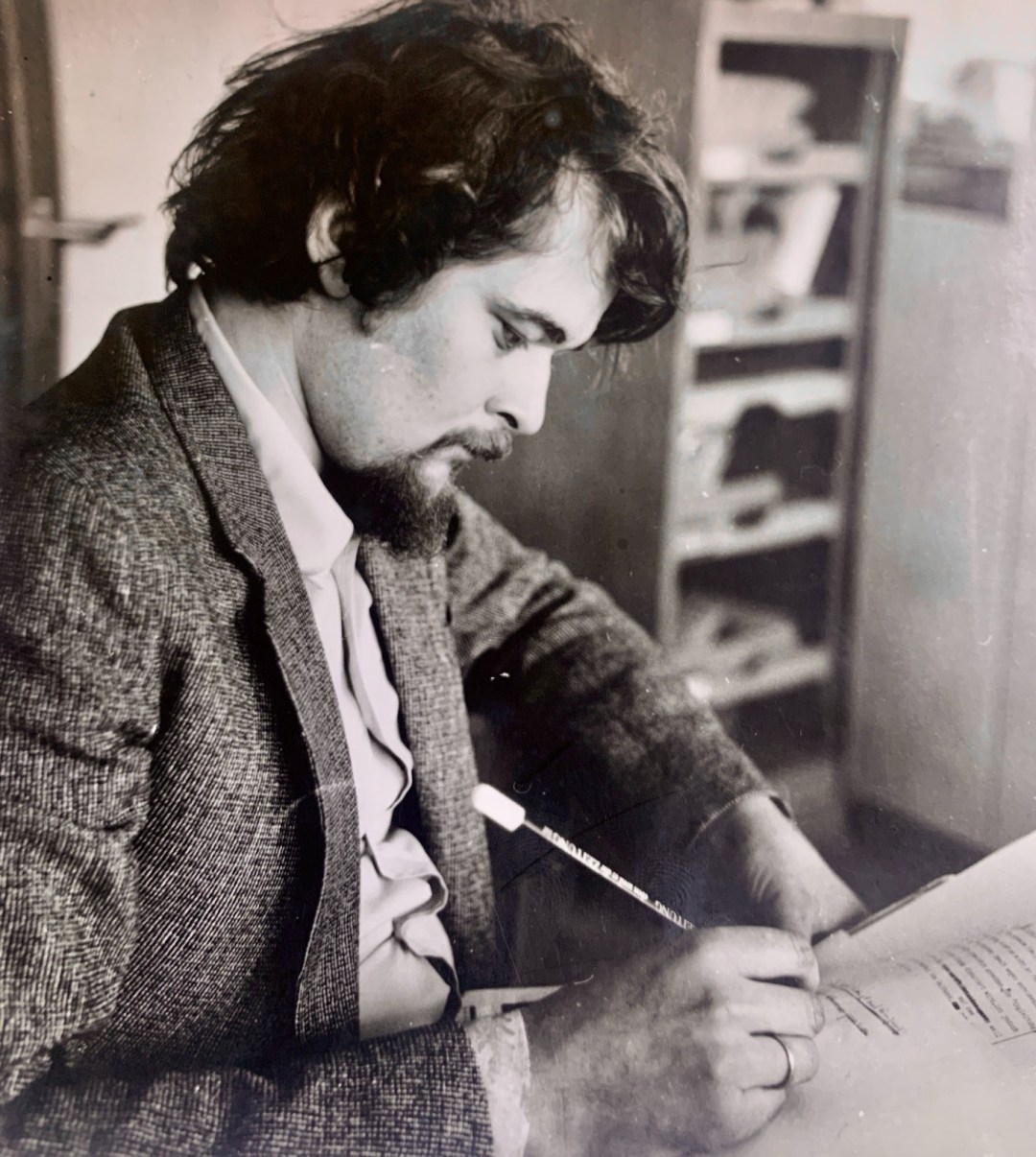Ich liebe Gadgets. Handys, Tablets, Computer, Streckenzähler. Selbst das digitale Stromablesen von Hydro Québec zaubert mir noch ein Lächeln ins Gesicht (das gefriert spätestens dann, wenn die Rechnung ins Haus flattert – per E-Mail natürlich). Auf mein neuestes Spielzeug hätte ich allerdings gerne verzichtet: Als frisch gekürter Diabetiker (Typ 1) schlägt es Alarm, sobald der Blutzucker in die Höhe schnellt.
Dass die Diagnose „Diabetiker“ kommen würde, war eigentlich klar. Wenn Dreiviertel der Bauchspeicheldrüse und die komplette Milz fehlen, gerät der Insulinhaushalt durcheinander. Wenn dann noch eine erbliche Vorbelastung hinzukommt, ist endgültig Schluss.
So weit, so doof.
Die gemessenen Werte kann die Ärztin direkt in ihrem System auslesen. Nach zwei Wochen hat der Sensor ausgesensort, dann muss ein neuer her. Er ist so groß wie eine Zwei-Euro-Münze und kostet etwa 150 Dollar. Und nein, die Krankenkasse kommt nicht dafür auf – es sei denn, man ist Privatpatient oder ein Kandidat für die Insulin-Spritze. Aber so weit sind wir noch nicht.
Der Glukose-Sensor ersetzt die umständliche und auch schmerzhafte Blutzuckermessung aus dem Finger oder Ohrläppchen. Die Funktion des Glukose-Sensors ist erschreckend und faszinierend zugleich. Es erschreckt mich, zu sehen, wie sehr man zum gläsernen Menschen wird, wenn Medizin und Technik ineinander übergreifen. Privatsphäre war gestern. Gleichzeitig fasziniert mich, was genau diese Interaktion zwischen Technik und Medizin ermöglicht.
Esse ich brav Gemüse und andere zuckerarme Nahrung, bleibt der Pfeil im grünen Bereich. Wenn’s dann doch mal ein Stück Weihnachtsstollen sein darf, bewegt er sich in Richtung Orange.

Dass die Zuckerkurve ausgerechnet bei meiner Lieblingsfrucht, der Mango, Alarm schlägt und feuerrot in die Höhe schießt, ist bedauerlich, aber nicht überraschend. Mangos, Bananen und Weintrauben gehören schließlich zu den süßesten Obstsorten überhaupt.
Einfacher ist die Ernährung durch die Diabetes-Diagnose nicht geworden – im Gegenteil. Es ist ein ständiger Spagat zwischen Verwöhnprogramm für die Bauchspeicheldrüse und Zuckerentzug wegen Diabetes. Vieles, was die Pankreas mag, ist Gift für Diabetiker. Leider gehört auch die Mango dazu.
Die unbeschwerten Zeiten sind also vorbei. Dafür habe ich jetzt ein neues Gadget.