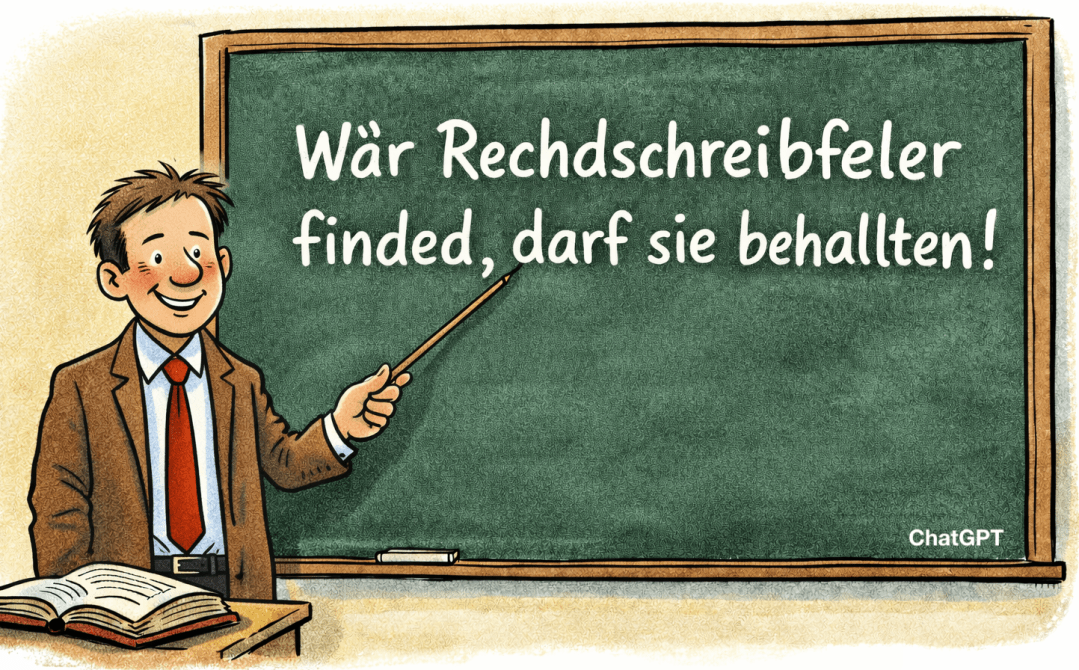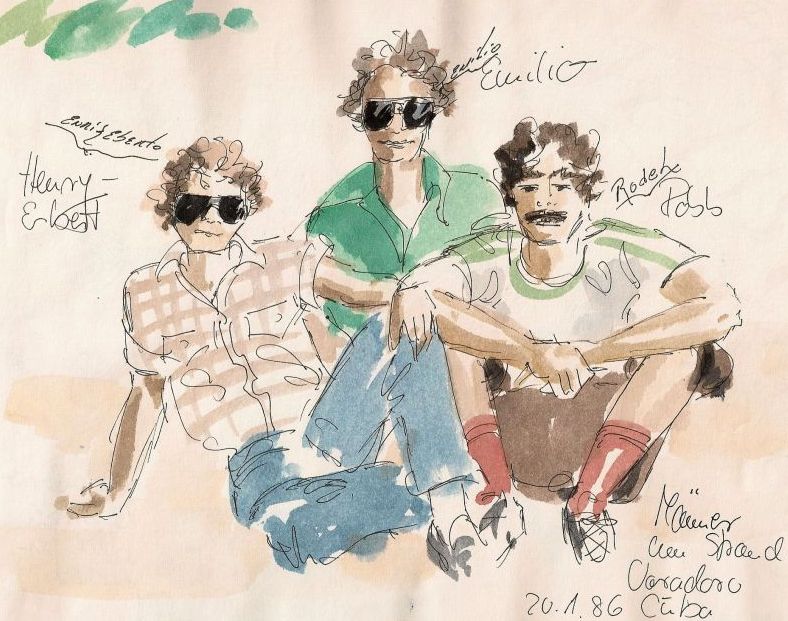Reden wir über Olympia. Oder besser: über die TV-Übertragungen der Olympischen Winterspiele. Die sind eine Sportart für sich: Plappern ohne Ende. Und für mich, der ich seit 45 Jahren im Ausland lebe, auch ein Lehrstück dafür, was in Deutschland sprachlich heutzutage geht und was nicht.
Die kurze Antwort: Sprachlich geht eigentlich alles. Geht es allerdings ans Menschliche, Allzumenschliche, hört die Toleranz schnell auf.
So sieht sich ein ARD-Eiskunstlauf-Kommentator namens Daniel Weiss seit ein paar Tagen einem Shitstorm (auch so ein Wort) ausgesetzt, der durch einen einzigen Satz ausgelöst wurde. Herr Weiss, den ich für einen fachlich außerordentlich kompetenten Kommentator halte, verstieg sich beim Anblick einer georgischen Eiskunstläuferin zu einer – zugegeben: ziemlich chauvinistischen – Formulierung, die nicht nur Feministinnen auf die Barrikaden brachte.
„Meine Herren da draußen“, hob Daniel Weiss zu seinem Kommentar an, „es tut mir echt leid, sie ist leider schon vergeben.“
Hinterher entschuldigte sich Herr Weiss für den Kommentar und nannte ihn „absolut unpassend“. Aber der Schaden war angerichtet.
Welcher Schaden eigentlich? Schon klar: Beim Eiskunstlauf geht es in erster Linie um sportliche Leistungen. Aber sind wir als TV-Zuschauer (und natürlich -innen!) angesichts der oft übermenschlichen Leistungen der Athleten nicht alle hungrig auf Menschliches? Menschelt es dann aber zu sehr, wie das Beispiel von Daniel Weiss zeigt, ist die Kacke am Dampfen.
„Die Kacke am Dampfen.“ Diesen Satz hat ein anderer Kommentator wirklich so von sich gegeben. Auch das mit der „saugeilen Schweinerei“ wurde wörtlich so gesagt. Und natürlich immer wieder: „echt geil“, „super geil“, „scheiße“ oder „schweinisch gut“.
Manchen Kommentatoren mögen grenzwertige Formulierungen wie diese in der Hektik der Live-Übertragung herausgerutscht sein. Andere setzen bewusst auf eine Sprache, die das Fernsehpublikum zielgruppengerecht anspricht. Motto: Junge Sportarten verlangen eine ungefilterte Sprache. Big Air, Snowboard Cross und Freestyle Skiing – allesamt super-extra-cool.
Ich finde es gut, sozusagen saugeil, dass im Fernsehen nicht mehr so geredet wird, als handle es sich um eine Ansprache zur Eröffnung des Katasteramts. Die Gedanken sind frei, warum soll es die Sprech-Sprache nicht auch sein?
Bei einem meiner Seminare ging es um das Thema „Starke Headlines“. In dem fiktiven Übungstext, für den eine Überschrift gefunden werden sollte, wurde ein Doppelmord in einem Landhotel verübt.
Während bei den meisten Seminar-Teilnehmern im Titel das Blut nur so triefte und von Mord und Totschlag die Rede war, schaffte es eine junge Kollegin mit einer – ernst gemeinten – Headline, die Runde zum Schmunzeln zu bringen.
Ihr Überschriften-Vorschlag: „Merkwürdige Vorgänge im Gaststättengewerbe.“
Nicht geil. Einfach Scheiße. Oder, um das Jugendwort des Jahres 2025 zu verwenden: Das crazy!