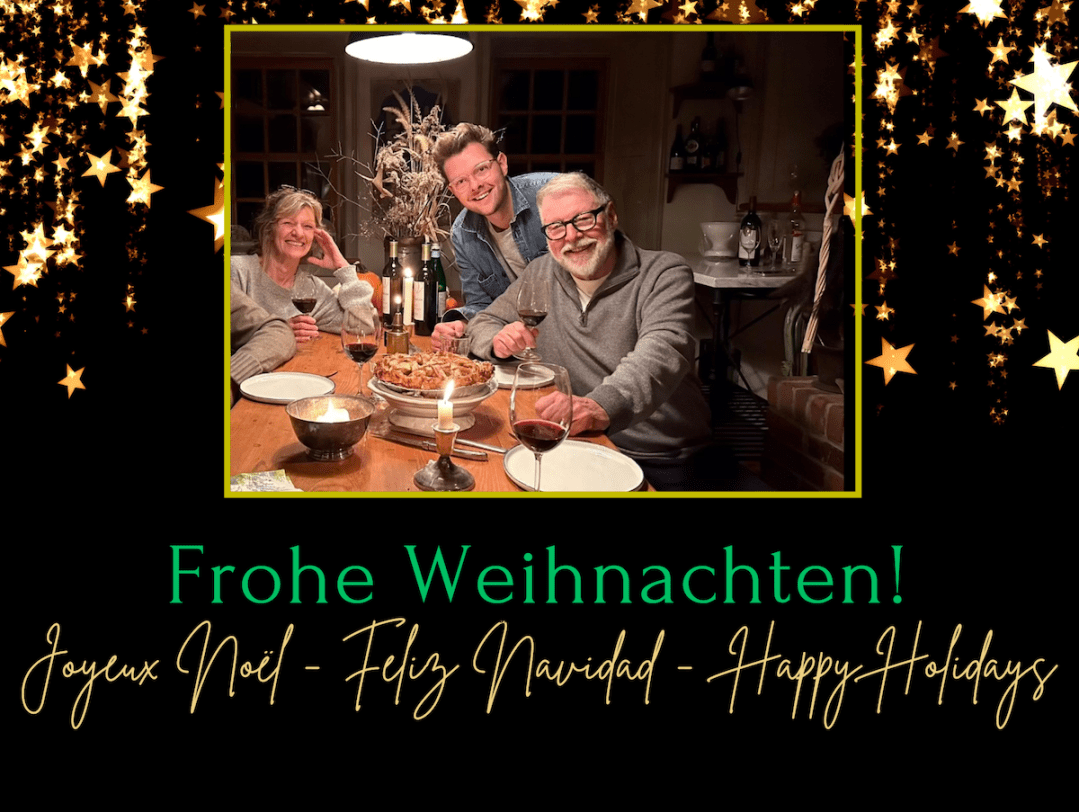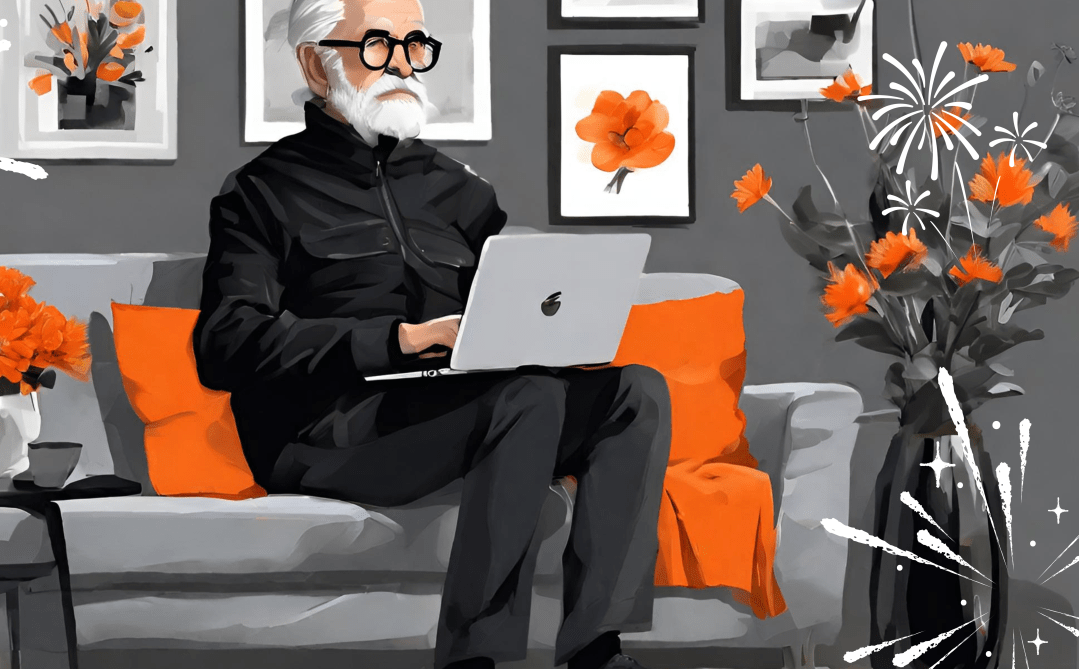Sie habe, sagt die junge Frau im hellblauen Kittel, ihre beiden Kinder seit einer Woche nicht mehr gesehen. „Um 4:30 Uhr gehe ich aus dem Haus, vor 21 Uhr bin ich selten zurück“. Sie arbeite, wie so viele Krankenschwestern in diesen Tagen, zwei Schichten hintereinander. Wegen des Streiks um höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen seien wertvolle Stunden verloren gegangen. Die müssen jetzt nachgeholt werden.
Ein Tag in der Notaufnahme eines Montrealer Krankenhauses lässt dich demütig und voller Respekt zurück. Aber auch wütend.
Warum ich am Mittwoch 15 Stunden im „Emergency Room“ des Jüdischen Krankenhauses in Montreal verbringen musste, tut hier nichts zur Sache. Es war dringend genug, um morgens um vier ans andere Ende der Stadt gefahren zu werden.
Die Notaufnahmen der Montrealer Krankenhäuser sind hoffnungslos überfüllt. Es fehlt an Personal und an Geld. Es fehlt auch an Equipment und Menschen, die diese Geräte bedienen können. Eine miserable Gesundheitspolitik hat sich im Laufe der Jahre zu einer Katastrophe hochgeschaukelt. So schlimm sind die Zustände, dass ein leitender Notfall-Mediziner jetzt vor einem vollständigen Kollaps des Systems warnte.
Dass mein Notfall dazuhin noch mitten in die Weihnachtszeit platzte, ließ sich leider nicht verhindern. Ich wurde zu einem der Patienten, die „unser Gesundheitssystem oft unnötigerweise verstopfen“, wie sich Gesundheitsminister Christian Dubé zu sagen erdreistet.
Ich mitten in der Nacht unnötigerweise in der Notaufnahme? Eher nicht.
Wie viele Patienten vor mir waren, kann ich nicht sagen. 70 vielleicht? Oder auch 100? Ich habe sie nicht gezählt. Ich weiß nur, dass die Ärztin, die mich morgens kurz vor fünf durchcheckte, abends noch immer im Dienst war, als ich gegen 18 Uhr das Krankenhaus verließ. Auch die Krankenschwester, die mir im Morgengrauen Blut abzapfte, fegte in der abendlichen Dunkelheit noch immer durch die Gänge. Und sie lächelte.
Als ich mich, weil ich im Eifer tatsächlich meine Stöcke im Empfangsbereich vergessen hatte, mühsam zum Scan schleppte und mich eine Pflegerin humpeln sah, packte sie ihr Sandwich wieder in die Tasche, schnappte einen Rollstuhl und schob mich über zwei Etagen. Stimmt, sagte sie leise, es sei ihre Mittagspause. „Aber ich kann Sie doch nicht einfach so durch die Gänge humpeln lassen!“
Demut ist ein Wort, das mir an diesem Tag mehr als einmal in den Sinn kam.
Irgendwann tönt ein Alarm aus dem Lautsprechersystem. „Code Lavender. Meet in Room 608“. Code Lavendel? Treffen im Zimmer 606? Eine Internet-Recherche schafft Klarheit. „Code Lavender“ ist das Stichwort, wenn ein Pfleger, eine Krankenschwester oder auch ein Arzt unter der psychischen Last zusammengebrochen ist. Es ist ein Hilferuf an Kolleginnen und Kollegen, sich in dem besagten Raum einzufinden und Beistand zu leisten. Durch aufmunternde Worte, eine Umarmung, ein Schulterklopfen. Oder auch nur durch ein Lächeln.
Während meines etwa 15stündigen Aufenthalts in der „Emergency“ des „Jewish Hospital“ wurde „Code Lavender“ zweimal ausgerufen.
Es ist jetzt irgendwann um die Mittagszeit. Ich sitze schon seit fast sieben Stunden in der Notaufnahme, bin am Einnicken. Ich wache auf, als meine Stöcke zu Boden fallen. Eine Krankenschwester ist schneller als ich, hebt sie auf und fragt mich, ob sie mir etwas zu Essen bringen könne. „Nein, danke“, sage ich. Sie lächelt, streicht mir über den Arm. Dann rennt sie zu einer Frau, die angefangen hat, vor Schmerzen zu schreien.

Ein Übersetzer in Hindi wird über die Lautsprecheranlage gesucht. Eine pakistanische Familie, Neuankömmlinge in Kanada, kann sich nicht mit dem behandelnden Arzt unterhalten. Die Hindi-Dolmetscherin ist innerhalb von 15 Minuten da. Sie ist nicht die Einzige, die heute bei Sprachproblemen hilft. Ein spanischer Dolmetscher wird gesucht – und gefunden. Später noch ein portugiesischer.
Ich staune voller Ehrfurcht, wie in diesem Tohuwabohu von schreienden Patienten, weinenden Müttern und überarbeitetem Krankenhaus-Personal doch noch alles funktioniert. Die Zahnräder sind gut geölt, die Menschen willig bis zur Selbstaufgabe.
Tapetenwechsel. Ich finde eine hübsche Ecke mit einem Großbild-Fernseher und einer Handy-Ladestation. Ich mache es mir gemütlich, höre Musik und wundere mich, dass ich der Einzige bin, der sich dieses lauschige Plätzchen ausgesucht hat. Ich rieche den Grund dafür. Ich sitze über Erbrochenem, die braune Masse daneben stinkt fürchterlich.
Ich benachrichtige einen Reinigungsmann, der gerade an mir vorbeirauscht. Er schüttelt hilfesuchend den Kopf. Er könne bei allem guten Willen nicht überall gleichzeitig sein.
Später treffe ich ihn wieder, diesen Mann. Er ist um die 40 und kommt aus El Salvador. Er und seine Frau arbeiten seit 22 Jahren im Jewish Hospital, einem der größten der Stadt. Jeder von ihnen verdient um die 30.000 Dollar im Jahr.
30.000 Dollar. Das ist genau die Summe, die sich im vorigen Sommer die Abgeordneten der Quebecer Landesregierung als Gehaltserhöhung genehmigt haben. Als GehaltsERHÖHUNG.
Am Abend wird eine Pressekonferenz des Gesundheitsministers im Fernsehen ausgestrahlt. Christian Dubé appelliert „an die Menschen da draußen“ nicht wegen jedem Schnupfen, wegen jeder Erkältung die Notaufnahme der Krankenhäuser aufzusuchen. „Sonst bekommen wir dieses Problem nicht in den Griff“.

Echt jetzt? Das soll die Lösung für diese Katastrophe im Gesundheitswesen sein? Es sind nicht die Kranken, die das System an den Rand des Kollaps gebracht haben. Es sind die Politiker, die ihre Prioritäten nicht auf die Reihe bekommen. Die eine Kommission nach der anderen ins Leben rufen, um die Fehler früherer Kommissionen zu kaschieren. Und sich mal kurz die Taschen um 30.000 Dollar voller machen, während das Krankenhauspersonal auf die Straße geht, um für ein paar Kröten mehr zu demonstrieren. Und hinterher dafür Doppelschichten arbeiten muss. .
„Ich möchte meine Kinder wenigstens zu Weihnachten sehen“, hatte mir die junge Frau gesagt, die seit einer Woche doppelte Schichten fährt. „Aber ich bin nicht sehr optimistisch, dass es klappt“.
Man könnte schreiend davonlaufen.
Ich habe lange gezögert, meine Erfahrungen in der Notaufnahme niederzuschreiben. So kurz vor Weihnachten, wo doch Glückseligkeit und Jingle-Bells angesagt sind.
Ich habe es trotzdem getan. Und irgendwo ist jetzt doch noch eine Art Weihnachtsgeschichte daraus geworden.
Passend zum Thema: Québec – Wo ist der Aufschrei?