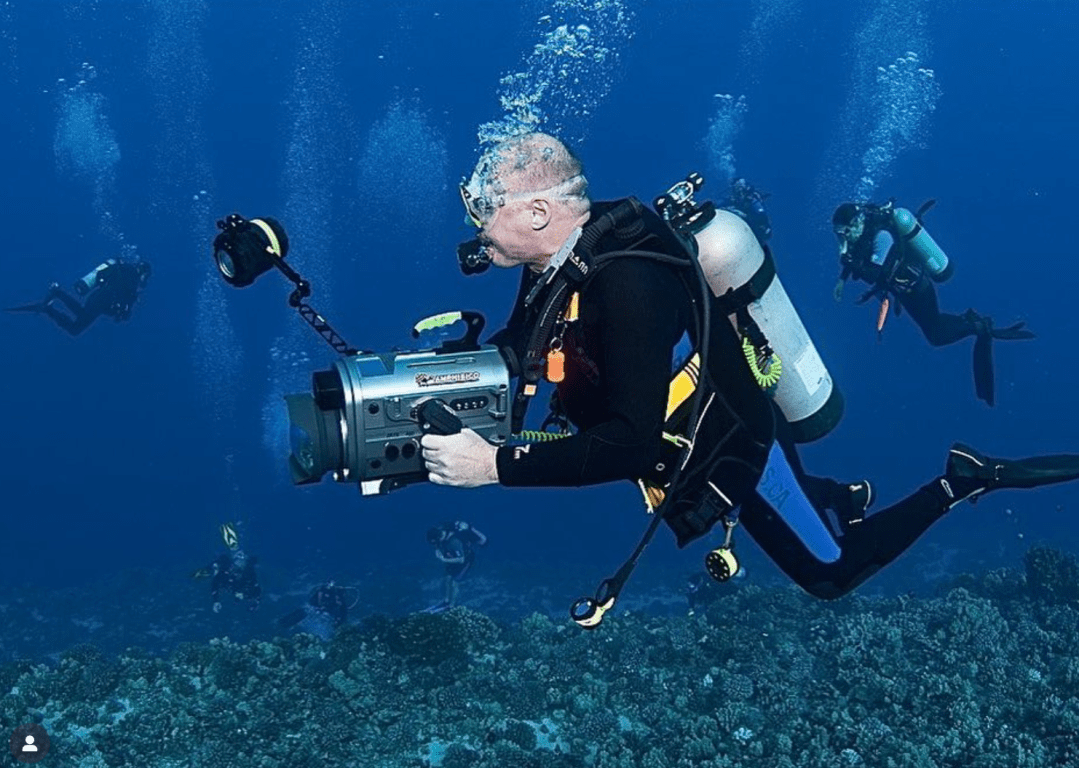Skispringen gehört nicht zu den Sportarten, die mich vom Hocker reißen. Auf der Skala meiner Lieblings-Disziplinen rangiert es irgendwo zwischen Hallen-Halma und Unterwasser-Eishockey. Dass ich trotzdem keine Vierschanzentournee, kein Neujahrsspringen im Fernsehen verpasse, hat nur ein bisschen mit sportlichem Interesse zu tun – dafür umso mehr mit meiner Kindheit in Ummendorf.
Wer in der Tiefe Oberschwabens aufgewachsen ist, wurde mit Publikumsveranstaltungen nicht gerade verwöhnt. Da mal ein Kreismusikfest, dort eine Pfarrweihe. Einmal kam sogar der Bischof persönlich nach Ummendorf – für mich ein Rockstar ohne Gitarre.
Natürlich wurde in Ummendorf auch Fußball gespielt. An einen wieselflinken Gipsergesellen mit Bierbauch erinnere ich mich noch gut. Nicht zuletzt, weil er, um sein Haupthaar während des Spiels zu bändigen, ein Gummiband um den Kopf trug. Super cool, fand ich das.
Das größte Fußballtalent in meinem Dorf war ein Nachbarjunge: Eduard „Ede“ Angele, er war zwei Jahre jünger als ich und wohnte genau gegenüber von uns. Er konnte laufen, dribbeln und schießen wie keiner sonst beim TSV Ummendorf. Dass er später bei Arminia Bielefeld in der Bundesliga spielte, verlieh ihm einen Status, den sonst wohl niemand im Dorf erreichte. Ein Bub aus der Saarstraße als Abwehrspieler in der Bundesliga – wow! Mit Edes älterem Bruder Josef bin ich bis heute noch befreundet.
Dass „einer von uns“ so weit kam, dass er am Wochenende namentlich im Radio und Fernsehen erwähnt wurde, manchmal sogar kurz im Bild auftauchte, das war schon was. 50 Spiele für Bielefeld und als Abwehrspieler sogar ein Tor geschossen – stramme Leistung.
Was das Ganze mit Skispringen zu tun hat?
Es gab da ein Ritual, das mir heute bei der Übertragung der Vierschanzentournee in Oberstdorf wieder in den Sinn kam. Nach dem Kirchgang am Neujahrsmorgen bog die Ummendorfer Landjugend fast geschlossen ins Gasthaus „Linde“ ab. Das war praktisch, denn die Wirtschaft lag nur ein paar Häuser von der Kirche entfernt, direkt neben dem Schloss.
Es war das Medium Fernsehen, das es mir angetan hatte. Liveübertragungen waren rar und geradezu sensationell für einen Dorfbuben, der sich lange Zeit nur vom Testbild berieseln ließ, weil tagsüber nicht gesendet wurde.
Um den Schwarzweiß-Fernseher der „Linde“ scharten sich Junge, ganz Junge, Alte und auch ganz Alte. Und alle starrten gebannt auf den Bildschirm, um das „Internationale Neujahrsspringen“ zu verfolgen. Noch heute habe ich den legendären Sportreporter Heinz Mägerlein („Sie standen an den Hängen und Pisten“) im Ohr, der bei uns einfach „der Mägerle“ hieß.
Wer gerade am Start war, wer gewann oder verlor oder gar verletzt wurde – das interessierte mich wenig. Viel spannender war es, als Zehn- oder Zwölfjähriger in einer richtigen Wirtschaft geduldet zu werden – ohne die Eltern.
Man trank „Bluna“ oder süßen Sprudel, der von irgendjemandem spendiert wurde. Dazu gab’s – ebenfalls als milde Gabe von irgendjemandem – einen Bierstengel. Wenn sich die Fangemeinde gerade besonders lautstark über einen misslungenen Sprung echauffierte, nahmen wir Buben auch mal einen kräftigen Schluck aus irgendeinem Bierkrug, der kurz unbeobachtet dastand.
All das ging mir heute beim Qualifikationsspringen der Vierschanzentournee durch den Kopf. Sportlich elektrisiert mich die Skispringere auch 65 Jahre später noch immer nicht so richtig. Einen Hardcore-Fan hatte ich trotzdem an meiner Seite: „Poppy“. Sie spitzte die Hundeohren und ließ keine Telemark-Landung aus den Augen.