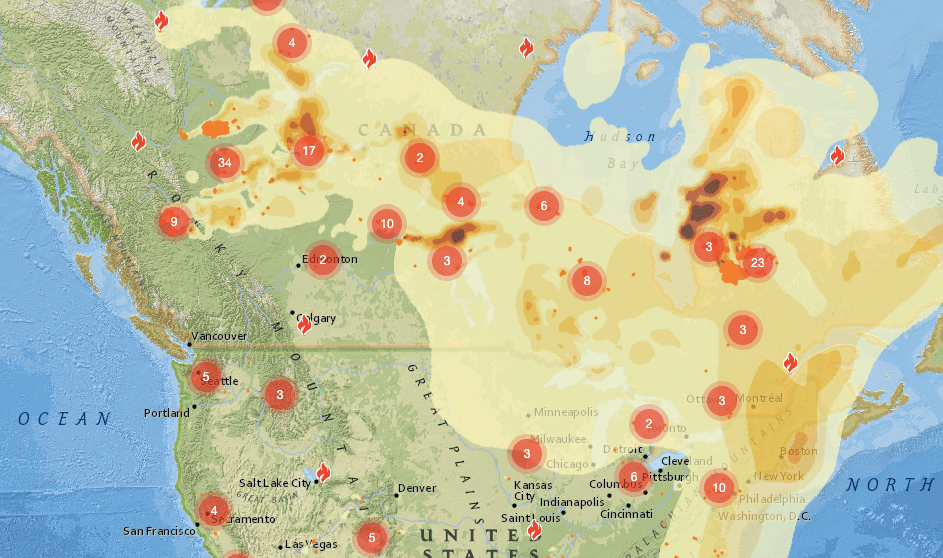Der Tag, an dem ich fast Millionär geworden wäre, beginnt wie viele Tage. Ich hole mein eBike aus der Tiefgarage, lege bei der Tankstelle an der Kreuzung noch einen Stopp ein, um Cash aus dem Geldautomaten zu ziehen. Und checke, weil ich schon mal dort bin, meinen Lottoschein.
Dass der Scanner nur ein Beep-Beep von sich gibt, passiert mir öfter. Als dann aber auch noch der Schriftzug aufblinkt: „Gehen sie zur Kasse!„, werde ich stutzig.
Mit dem Lottoschein in der Hand also schnurstracks zum Kassierer. „Yaris“ steht auf seinem Hemd. Gut so.
Ich kenne Yaris schon ein bisschen, weil ich ihn mal verteidigt hatte, als ihn eine angetrunkene Frau des Diebstahls bezichtigte. Angeblich hatte er der Frau 50 Cents zu wenig Wechselgeld herausgegeben. Yaris meinte damals, die spinne wohl, die Alte. Wegen 50 Cents riskiere er doch nicht seinen Job.
Mir tat Yaris damals ein bisschen leid. Vielleicht merkte ich mir deshalb seinen Namen und sein Gesicht.
Ein Glück, denke ich, dass ausgerechnet heute Yaris Dienst hat. Er würde mir bestimmt schnell und unbürokratisch helfen können.
Yanis hält seinen Handscanner auf den Lottoschein und verkündigt feierlich: ‚We have a winner!“
Seine schwarzen Augen leuchten. So sieht also ein Haitianer aus, wenn er Freude empfindet, denke ich.
Als Yaris zum Telefonhörer greift, mutet sein Lächeln plötzlich unterkühlt an. lch bilde mir ein: Es ist das Lächeln eines Menschen, der keine Siegertypen mag.
Sag schon, Yaris, wieviel sind’s? Hunderttausend? Fünfhunderttausend? Eine Million?
Beim Frühstück hatte ich gelesen, dass bei der Lotteriegesellschaft seit einem Jahr 70 Millionen Dollar darauf warten, von einem Gewinner abgeholt zu werden. Heute würde der Betrag verfallen und in den Jackpot zurückgehen.
Meine Güte, schießt es mir durch den Kopf, was mache ich nur mit 70 Millionen? Ganz viel spenden, das auf jeden Fall. Aber nicht alles, versteht sich.
Der Penner, der ab und zu mein eBike bewacht, solange ich im Supermarkt bin, würde mindestens 100 Dollar bekommen. Ach was, tausend. Aber dann hätte ich ja immer noch 69-Millionen-999tausend Dollar übrig. Und klar, Yaris soll auch einen ordentlichen Batzen abbekommen, vesteht sich von selbst. Wer denn noch?
Nichts als Stress, denke ich für einen Moment. Jetzt weiss ich auch, warum das Glück bei den meisten Lottogewinnern nicht lange anhält.
Yaris wartet am Telefon noch immer auf seinen Gesprächspartner und klopft nervös mit dem Kugelschreiber auf den Schreibblock. Dabei würdigt er mich keines Blickes, bilde ich mir ein.
Hinter mir hatte sich eine kleine Menschenschlange gebildet.
Wetten, dass keiner von denen auch nur ahnt, dass sie einen veritablen Multimillionär vor sich haben?
Endlich. Yaris legt los. In einem unverständlichen Gemisch aus Kreolisch, schlechtem Englisch und Quebecois, das sich für mich wie Polnisch rückwärts anhört, plappert er ins Telefon.
Nach 30 Sekunden ist das Gespräch beendet. Per Knopfdruck lässt Yaris die Kassenschublade herausschnellen.
„Five Bucks, my friend!“, strahlt er, und händigt mir einen Fünf-Dollar-Schein aus. Es tue ihm leid, dass es so lange gedauert habe. Zum 1. Juli hätten sich die Ausspielregeln geändert. Er musste erst bei seinem Boss nachfragen, ob er mir meinen Gewinn in bar aushändigen dürfe oder als Freispiel.
Fünf Dollar also. Besser als „ein Maul voller Reißnägel“, wie man in Ummendorf sagt.
Ich ziehe betripst von dannen und kann mich nicht einmal mehr daran erinnern, ob ich mich bei Yaris für seine Mühe bedankt habe.
Leicht verschüchtert und mit eingezogenem Kopf gehe ich an der wartenden Menschenschlange vorbei. Dann sattle ich mein Fahrrad und reite mit einer Handvoll Dollar in den Großstadtverkehr.