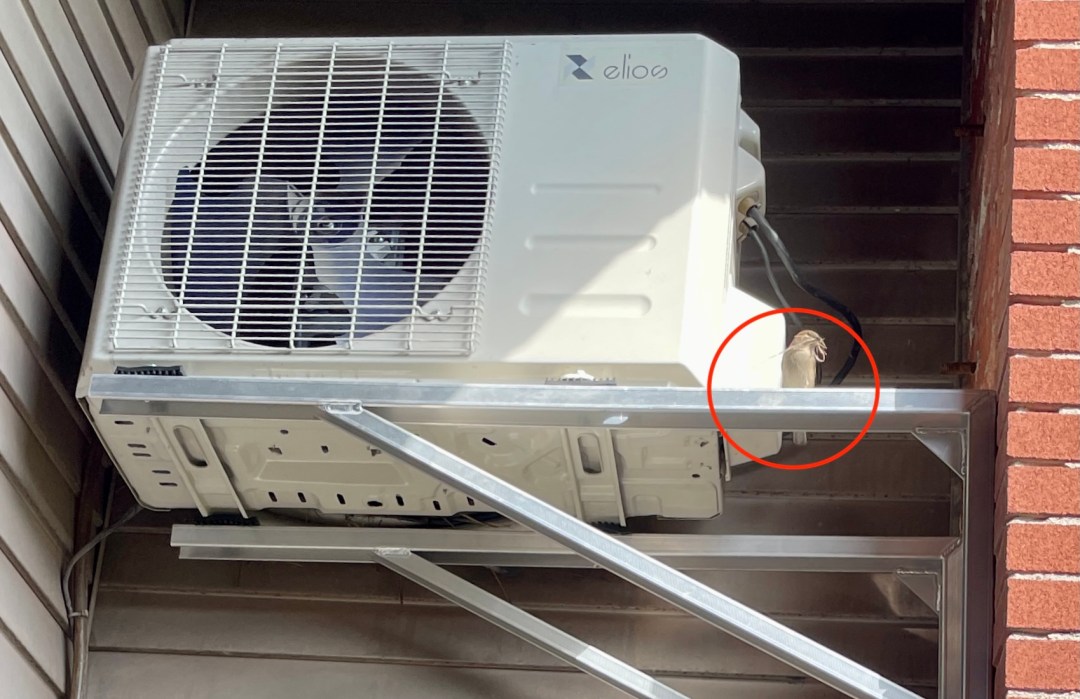Wenn Freunde gehen, geht auch ein Stück deiner Vergangenheit. Das wurde mir heute Nachmittag klar, als ich mich von meinem Freund Marc verabschiedete. Wir trafen uns ein letztes Mal im „Café Bicyclette“, einem Radler-Treffpunkt, an dem wir uns schon so oft verabredet hatten.
Marc zieht morgen nach Ottawa, „nicht aus der Welt“, wie man so sagt, nur zweieinhalb Autostunden von hier. Und doch wird meine Welt ohne Marc nie mehr das sein, was sie einmal war.
Marc – das ist Dr. Marc Paquet, Kinderkardiologe im Ruhestand. Ein Mann, der das Herz am rechten Fleck hat. Wie vielen Kindern er durch seine Eingriffe das Leben gerettet hat, werden wir nie erfahren. Aber eines weiß ich sicher: Marc muss ein großartiger Kinderarzt gewesen sein. Die Hingabe, mit der er noch heute über seine Arbeit spricht, lässt auf viel Liebe für seinen Beruf schließen.
Für mich war Marc nie der Kardiologe, der Kinderherzen heilt. Er war der Kumpel, der Leidenschaften mit mir teilt: Reisen in ferne Länder. Fahrradfahren. Und Storytelling. Beim Radeln konnte ich bis zum Schluss mithalten. Bei seinen Reise-Erzählungen musste ich passen.
Ich kenne niemanden – außer vielleicht meinen Piloten-Freund Jörg – der mehr gereist ist in seinem Leben als Marc. Er kennt die kältesten Ecken der kanadischen Arktis und die abgelegendsten Plätze im Jemen. Wenn er über Tokio spricht, glaubst du, du sitzt nicht auf irgendeiner Parkbank, sondern im IMAX-Kino. So bunt, so schrill, so exotisch. Plaudert er über Argentinien, möchtest du nur noch Tango tanzen.
Zuerst war es sein Beruf, der Dr. Marc Paquet als gefragten Kinderkardiologen in beratender Funktion in die Welt hinausführte. Später besuchte er viele dieser Orte erneut als Tourist. Und überall gab es Begegnungen mit Menschen – und Menschen mit Geschichten.
In Quebec City wurde Marc vor mehr als 80 Jahren geboren. In Montreal, so hatte ich gehofft, würde er sesshaft bleiben. Nachdem er hier bereits einen Großteil seiner Karriere als Kinderkardiologe verbracht hatte, zog es ihn in die Welt hinaus – und später doch wieder zurück nach Montreal. Für immer, wie ich geglaubt hatte. Ich sehe von meinem Fenster aus auf seinen Balkon auf der anderen Seite des Flusses.
Doch jetzt nehmen er und seine Frau Millie Abschied und ziehen nach Ottawa. Es sind persönliche Gründe, die für den Ortswechsel verantwortlich sind. Und natürlich wünschen Lore, Cassian und ich ihnen nur das Beste in der Bundeshauptstadt.
Unsere gemeinsamen Radtouren werden mir fehlen. Unsere Verschnaufpausen – es waren viel mehr als nötig – auf irgendwelchen Parkbänken, in Kneipen und Cafés sowieso.
Marc liebt es, Deutsch mit mir zu sprechen. Er konnte es noch aus seiner Zeiit, da er an einer Klinik in München praktizierte. Der Feinschliff fehlt, aber das Herz kennt keine Sprach- und Ländergrenzen. Ich musste ihm heute Nachmittag beim Abschied versprechen, auch künftig Textnachrichten auf Deutsch zu schicken. Ein guter Mediziner gibt eben nicht auf.
Ich bin meinem Freund Peter in Sherbrooke unendlich dankbar, dass er mir seinen Freund Marc vor vielen Jahren anlässlich einer Geburtstagsfeier in mein Leben gespült hat. Dass uns drei diese Männerfreundschaft nach so langer Zeit noch immer verbindet, ist ein Glücksfall. Und gibt mir Hoffnung, dass sie noch viele Jahre anhalten wird.
Ich habe keinen Zweifel daran, dass der Kardiologe Dr. Marc immer wieder gern nach Montreal zurückkommt. Schließlich ist es die Stadt meines Herzens.