
Kurz vor der Landung in Tokio legt sie die Hand auf meinen Arm und flüstert mir ins Ohr: „Japan. Dass ich das noch erleben durfte!“ Über Curaçao meint sie, genau so habe sie sich das Karibische Meer immer vorgestellt. Ich will aber unbedingt noch kurz nach Buenos Aires. New-York wäre auch nicht schlecht. „Why not Hongkong?“, sagt die Frau neben mir.
„Machen wir alles“, sagt der Fotograf und schießt wie aus dem Maschinengewehr Hunderte von Bildern hintereinander. Seine Regieanweisungen sind überschaubar: „Immer schön den Flug genießen, zwischendurch aus dem Fenster schauen, lesen, im Bordmagazin blättern, lachen, plaudern. Sagte ich schon genießen?“ Nur essen ist verboten. „Die Speisen bitte nur mit der Gabel berühren“, lautet die Ansage.
Als Model für einen Tag gehört die Welt dir und deinen Träumen.
Ich sitze im komfortablen Erste-Klasse-Abteil eines Airbus 320, von dem Teile der Kabine in einem riesigen Montrealer Fotostudio stehen. Vor mir ein Tablett mit dem Feinsten, das die Bordküche heute zu bieten hat – alles echt, nichts hier ist fake. Als der Spinatsalat dann im Laufe der Fotosession etwas an Frische verliert, kommt die Foodstylistin mit der Sprühflasche.
Um mich herum wirbeln zwei Dutzend Männer und Frauen: Techniker, Fotografen, Maskenbildnerinnen und Friseure, zwei Ankleidefrauen und eine Food-Stylistin, Beleuchter, Bildabgleicher, Producer und andere Kreative. Auch eine Buchhalterin ist dabei. Sie ist für den Zeitplan verantwortlich – und damit für die Gage.
Ein kleines Problem gibt’s lediglich beim Ankleiden. Die coole Hose, die die Stylistin für mich ausgedacht hatte, platzt bei der Anprobe aus allen Nähten. Da kommt dann die Schneiderin ins Spiel. Sie erweitert kurzerhand den Bund, indem sie dem hinteren Teil der Hose zwei schnelle Schnitte verleiht – dort, wo auch die Kamera garantiert nicht hinsieht.

Die Schuhe? Zwei Nummern zu klein. Aber ein richtiges Model muss auch mal leiden können.
Die dunkelhäutige Dame neben mir heißt Elaine. Sie ist für heute meine Frau – Ehering inklusive. Elaine ist hauptberuflich Fotomodell und fliegt mit mir in vier Stunden um die Welt. Vier Stunden für ein paar Fotos, die in der neuen Werbekampagne der Airline verwendet werden. Auf Plakaten und Reiseprospekten, im Internet und auch im Bordmagazin.
Den Namen der Airline darf ich nicht nennen. Aber Sie, die Sie meinen Blog lesen, sind die Ersten, mit denen ich die Fotos nach Freigabe teilen werde.
Und wie kommt man zwei Monate vor seinem 70. Geburtstag zu so einem Model-Gig? Ganz einfach: Man ist sich selbst. Die Scouts waren bei der Suche nach einem „authentisch aussehenden älteren Mann“ bei meiner Agentin gelandet. Die hatte gerade so einen im Angebot. Auf dem Ablaufplan lese ich später: „Elaine and Herbert, International Couple“.
Modeln macht Spaß, aber es macht auch hungrig. Doch das Leben ist nicht immer fair. Während sich die Kreativen um dich herum mit Sandwiches, Salaten und Getränken vom Catering-Service eindecken, starren Elaine und ich noch immer auf einen Teller, der auch nach Stunden noch frisch wie aus dem Bordmagazin aussehen soll.
Elaine hat nicht nur Erfahrung als Model. Sie hat auch Sinn für Humor. „Glaub ja nicht, es geht hier um uns.“, sagt sie. „Hier dreht sich alles um den Spinat“.













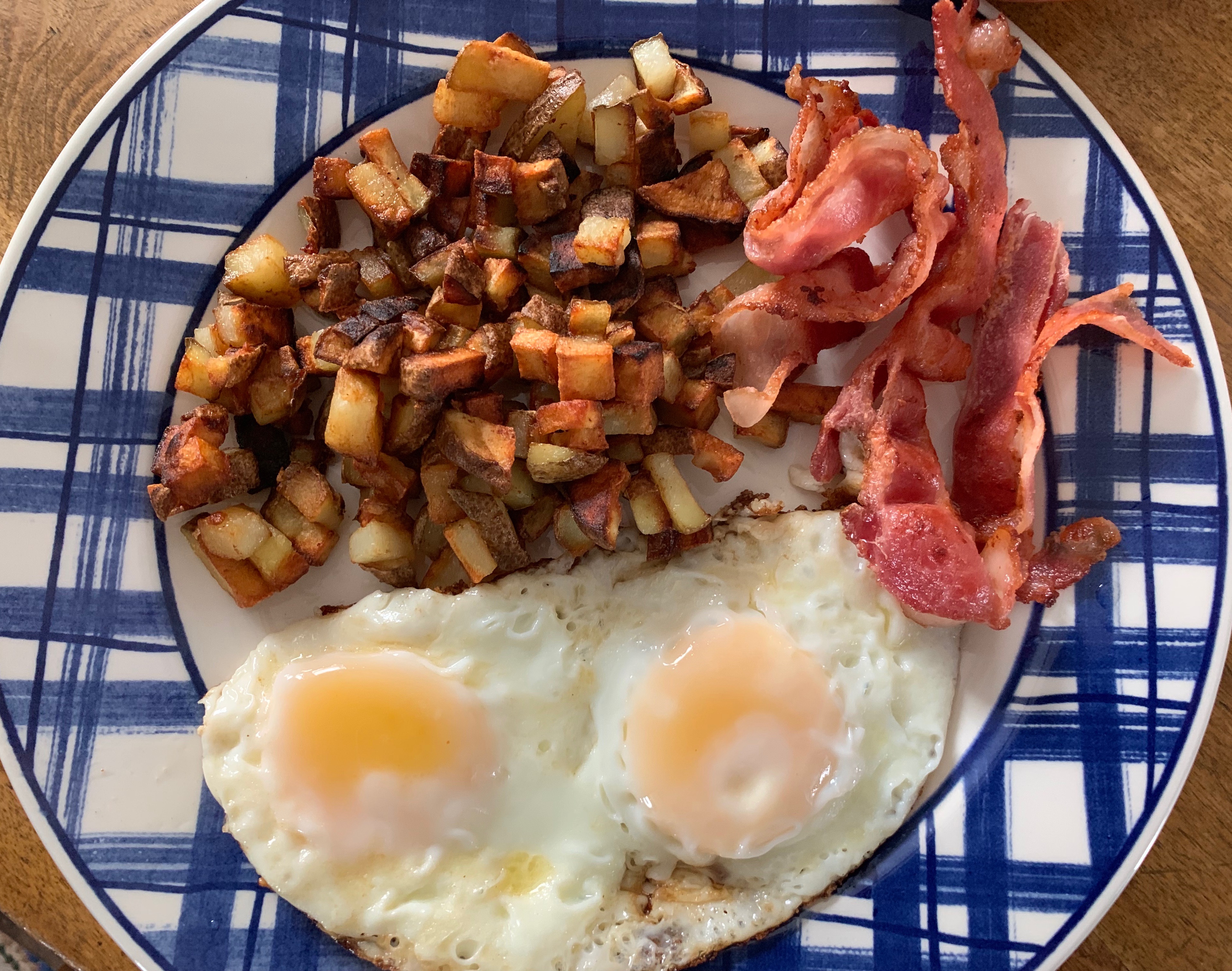





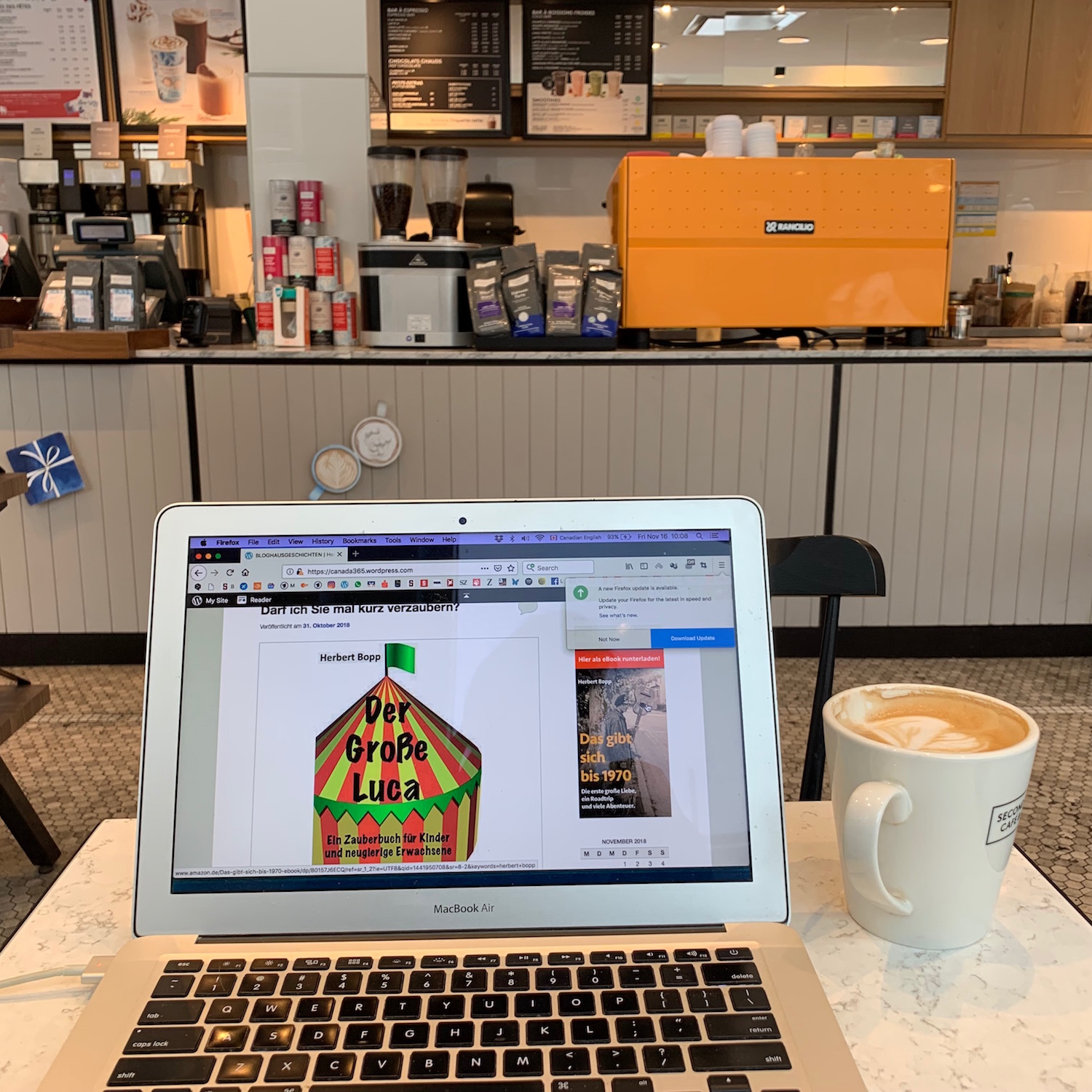 Man nennt es Arbeit, aber es macht einfach nur Spass. Texte schreiben, Mails beantworten, Fotos sortieren – das alles in einem Café, in dem der Name Programm ist: Second Cup. Von dort, an meiner Montrealer Lieblingsstraße gelegen, kommt dieser Blog. Der Boulevard St. Laurent lässt grüßen. Und Frank O’Dea auch.
Man nennt es Arbeit, aber es macht einfach nur Spass. Texte schreiben, Mails beantworten, Fotos sortieren – das alles in einem Café, in dem der Name Programm ist: Second Cup. Von dort, an meiner Montrealer Lieblingsstraße gelegen, kommt dieser Blog. Der Boulevard St. Laurent lässt grüßen. Und Frank O’Dea auch.