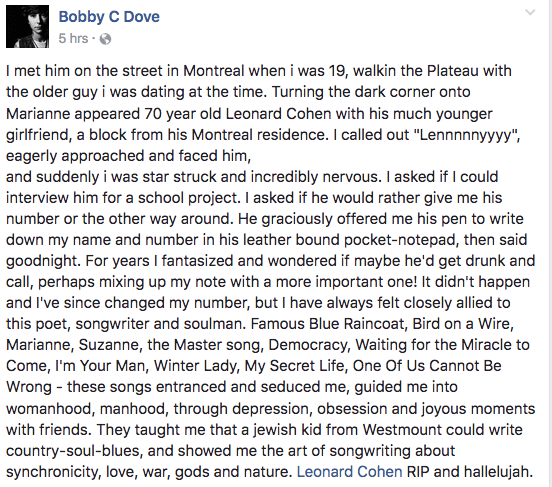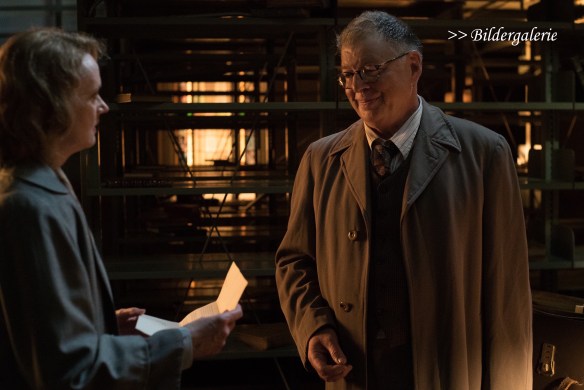Eigentlich ist sie viel zu jung für so ein Wartezimmer. Wer sich hier trifft, hat’s auf den Ohren, in der Nase oder im Hals. Emma hat nichts von alledem. Sie wartet an diesem Morgen in der HNO-Klinik darauf, dass ihre Stimmbänder untersucht werden. Am Nachmittag hat sie ihr Examen. Sie studiert Gesang am Konservatorium.
Eigentlich ist sie viel zu jung für so ein Wartezimmer. Wer sich hier trifft, hat’s auf den Ohren, in der Nase oder im Hals. Emma hat nichts von alledem. Sie wartet an diesem Morgen in der HNO-Klinik darauf, dass ihre Stimmbänder untersucht werden. Am Nachmittag hat sie ihr Examen. Sie studiert Gesang am Konservatorium.
Wenn sie die Prüfung schafft, kann sie sich Hoffnung machen auf eine Karriere als Opernsängerin. Bleibt sie auf der Strecke, gibt es in Montreal 100 Bars und Kneipen, wo Talente wie Emma gefragt sind.
Aber daran mag sie an diesem Morgen gar nicht denken.
Das iphone4, das sie jetzt aus einer selbst gestrickten Hülle zückt, hat schon bessere Zeiten gesehen. Der Mikrofilm löst sich vom Bildschirm, die Kopfhörerbuchse hat einen Wackelkontakt. „Shit“, sagt Emma, von der ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal weiss, dass sie Emma heißt.
Als sie sich die Knöpfe ins Ohr stopft und das Handy auf ein Notenblatt legt, fängt sie an, auf der Klavier-App ihres iphones zu klimpern. Als sie dann schließlich auch noch tonlos gehauchte Mundbewegungen macht, geht es mit mir durch. „Darf ich fragen …“, frage ich. Und sie: „Gerne“. Nimmt die Kopfhörer aus dem Ohr und stellt sich vor: „Emma“.
Emma ist sichtlich nervös, aber auch glücklich. Auf so einen Tag wie diesen hat sie drei Jahre gewartet. Examen! Opernsängerin! Und dann, auch das noch: Frisch verliebt! In einen Jungen aus Südfrankreich. Cello-Student. Als sie in seine WG zog, lebte er mit einer Violinistin zusammen. Emma kam, die Geigerin blieb. „Wir verstehen uns prima“, sagt Emma.
Die Gnade der Jugend.
Aber auch in einer noch so glücklichen Dreier-Konstellation ziehen manchmal Wolken auf. Eine Geigerin, ein Cellist und eine angehende Opernsängerin – sie alle müssen üben, üben, üben, wenn sie ans Ziel kommen wollen. Und genau daran hakt es.
Traktiert die Violinistin gerade ihre Geige, haben das Cello und die Sängerin nichts zu melden. Will die Operndiva von morgen heute mal üben, ist musikalisch kein Platz mehr für einen dominanten Cellisten.
Aber irgendwie funktioniert immer alles.
Emma hat früh gelernt, was es heißt, sich in einer Gemeinschaft zu behaupten. Ihre Gemeinschaft war ihre Familie. Der Vater, Geologe, stammt aus Whitehorse im Yukon. Abgeschiedener geht nicht in Kanada. Die Mutter, Krankenschwester, kommt aus der Atlantik-Provinz Nova Scotia. Getroffen hat man sich in Val-d’Or, 550 Kilometer nördlich von Montreal. In Val d’Or ist Emma aufgewachsen. Zwischen Goldgräbern, Minenarbeitern und Trunkenbolden.
Emmas Familie war anders. Da wurde schon früh musiziert und bald stand fest: „Opernsängerin, das wär’s“.
Jetzt sind Opernsänger in Val-d’Or ungefähr so verbreitet wie Fallensteller in Bielefeld. Aber wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, kommt der Berg eben zum Prophet. Emma wusste nach der High-School: Nur ein Umzug nach Montreal bringt mich meinem Ziel näher.
So packte sie also ihre Siebensachen und fuhr im Familienauto die acht Stunden vom Norden in den Süden. Und landete geradewegs in einer Wohngemeinschaft, die aus einem Cellisten und einer Geigerin besteht.
„Deutschland!“, schmachtet Emma, nachdem sie sich nach meiner Herkunft erkundigt. Davon träume jede angehende Opernsängerin. Den ersten Schritt in Richtung Deutsche Diva hat sie schon gemacht. Im Konservatorium belegt sie einen Kurs „Deutsche Phonetik“. Hier geht es um die perfekte Aussprache, nicht um Grammatik.
„Pavarotti“, sagt Emma, „konnte stundenlang deutsche Lieder singen“. Verstanden habe er davon kein Wort.
Die Sprechstundenhilfe kommt. Jetzt ist Emma an der Reihe. „Auf Wiederhören in Deutschland!“, ruft sie mir noch zu.
Sie spricht den Satz perfekt aus. Ich bin mir nicht sicher, ob sie ihn auch verstanden hat.

 Irgendwo im Montrealer Villenviertel Westmount setzt sie sich neben mich auf eine Bank, zündet eine duMaurier an, inhaliert tief und bläst den Rauch genüsslich in die Novembersonne. „Stört es dich?“, fragt sie. “Nicht die Bohne“. Sie heisse übrigens Reina, “das ist spanisch für Königin“. Eine fürstliche Begegnung, wie sich eine Stunde später herausstellen sollte.
Irgendwo im Montrealer Villenviertel Westmount setzt sie sich neben mich auf eine Bank, zündet eine duMaurier an, inhaliert tief und bläst den Rauch genüsslich in die Novembersonne. „Stört es dich?“, fragt sie. “Nicht die Bohne“. Sie heisse übrigens Reina, “das ist spanisch für Königin“. Eine fürstliche Begegnung, wie sich eine Stunde später herausstellen sollte. Mein erster Gang wird mich heute an den Parc du Portugal führen. Dort, in der Nähe meiner Lieblings-Flaniermeile, dem Blvd. St.-Laurent, lebte Leonard Cohen. In der vergangenen Nacht ist der Held meiner Jugend im Alter von 82 Jahren verstorben. Wenn jemand stirbt, leben Erinnerungen auf. Hier sind einige davon:
Mein erster Gang wird mich heute an den Parc du Portugal führen. Dort, in der Nähe meiner Lieblings-Flaniermeile, dem Blvd. St.-Laurent, lebte Leonard Cohen. In der vergangenen Nacht ist der Held meiner Jugend im Alter von 82 Jahren verstorben. Wenn jemand stirbt, leben Erinnerungen auf. Hier sind einige davon: