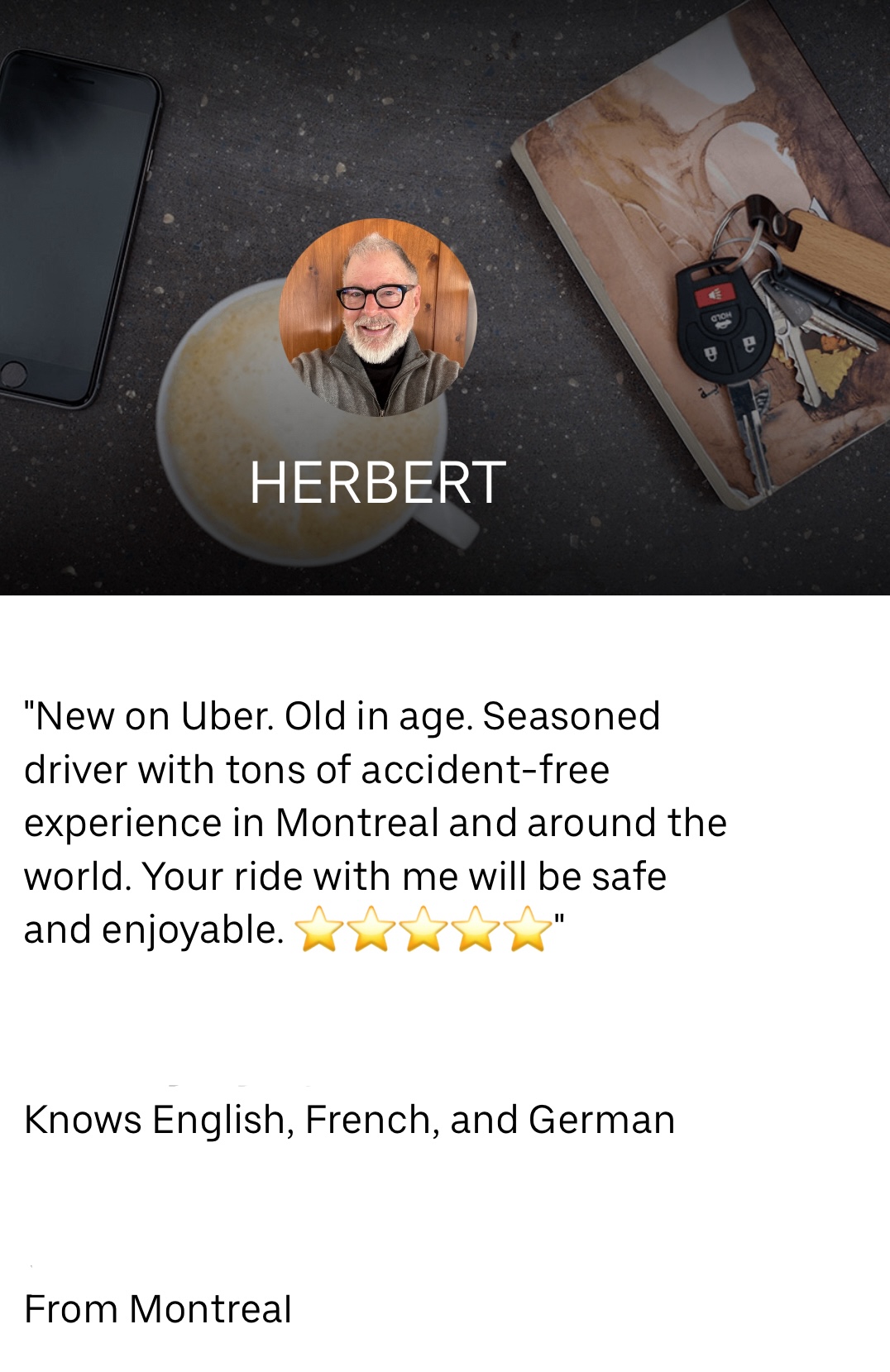So schön hatte ich mir den ersten Tag als Uber-Chauffeur nicht vorgestellt: Acht Trips mit Tips und als Sahnehäubchen noch Fünf-Sterne-Bewertungen – mehr kann ein Neueinsteiger auf Montreals Straßen nicht erwarten.
Doch nicht Sternchen, Trinkgeld und etwas mehr als eine Handvoll Dollar sind das Entscheidende. Es sind die Menschen mit ihren Geschichten, die ich heute zwischen Laval, Little Italy und île des Sœurs getroffen und gehört habe.
Was eigentlich eine kleine Schnuppertour werden sollte, endete in einem sechsstündigen Arbeitstag hinterm Steuer. Wobei: Arbeit ist ein großes Wort für so eine Spaßveranstaltung.
Schon der Auftakt war verheißungsvoll. Rosalie und Marco, ein superfreundliches Studentenpaar aus Montreal, wollten vom Baumarkt „Home Depot“ im Stadtteil St. Henri zum Shopping-Centre „Plaza Alexis Nihon“ in der Innenstadt chauffiert werden.
Erst bei der Ankunft am Ziel outete ich mich als absolutes Greenhorn. „So cool“, sagte Rosalie zu meiner allerersten Uber-Fahrt. Das müsse sie unbedingt ihrem Papa erzählen. Der hocke seit seiner Pensionierung nur noch den ganzen Tag vor dem Fernseher. Sie finde es toll, wie sinnvoll ich meine Zeit verbringe. „Und dann noch mit so einem schönen Auto“.
Das mit dem schönen Auto ist übrigens so eine Sache. Bei einem 75-Jährigen, der mit einem kleinen, aber feinen Mercedes Uber-Taxi fährt, fühlt sich so ein Trinkgeld dann vielleicht doch nicht so richtig an. Marco und Rosalie ließen es sich trotzdem nicht nehmen, ein paar Taler bargeldlos aufs Konto zu appen.
Eigentlich hätte mir diese Fahrt als Einstand genügt. Aber die Uber-App lief jetzt, da es zu regnen angefangen hatte, auf Hochtouren. Acht Fahrten wurden insgesamt daraus, fast genau so viel musste ich ablehnen, weil ich entweder bereits Passagiere im Wagen hatte oder mir ein Nickerchen auf einem charmanten Parkplatz in irgendeinem Industriegebiet wichtiger schien.
Nächster Stopp: Das Sheraton Hotel, mitten im Bankenviertel. Ein freundlicher Geschäftsmann aus Indien wollte in Begleitung einer jungen Brasilianerin – beide wohnaft in Dubai – in die Vorstadt gefahren werden. Dort wartete ein Mietwagen auf das Paar. Mit dem sollte es am nächsten Tag in die Berge gehen.
„Sergei“ war der dritte im Bunde. Sergei schwieg von Anfang bis zum Schluss. Der große Schweiger hatte vor einem russischen Restaurant auf den Fahrdienst gewartet. Sein Ziel: Ein schnuckeliges Hotel am Alten Hafen.
Weiter ging’s mit:
- Drei jungen Türken, die sich noch nicht einig sind, ob sie mit Montreal die richtige Wahl für ihr Studium gewählt haben.
- Einer jungen Kroatin, die eigentlich zum Studieren hierhergekommen war, nur um sich schnurstracks in einen Frankokanadier zu verlieben und jetzt in einer Plastikfabrik arbeitet.
- Einem weiteren Türken, Anwalt in einer Montrealer Kanzlei. Der hatte Mama und Schwester aus Istanbul zu Besuch und wollte ihnen ein bisschen die Stadt meines Herzens zeigen.
Als der Regen immer schlimmer wurde und ich mich in der Abenddämmerung schon auf den Heimweg gemacht hatte, beepte die Uber-App schon wieder. Diesmal war es eine Frau aus Brüssel, die von einem feinen Hotel in ein noch feineres Spa auf île des Sœurs chauffiert werden, wollte.
Die Wohninsel im Sankt-Lorenz-Strom gilt verkehrstechnisch als Albtraum. Aber Madame versäumte es nicht, den älteren Herrn mit Komplimenten zu überschütten. Da war vom sauberen Auto, über die Stadtkenntnisse bis zur Playlist bei Spotify alles an Lob dabei.
Also alles paletti nach dem ersten Uber-Tag?
Nicht ganz. Das Navi, das Teil der Uber-App ist, schwächelt. Hausnummern sind oft Glücksache, Umleitungen werden, wenn überhaupt, erst in letzter Sekunde angezeigt. Der Umstieg auf die GPS-Applikationen „Waze“ oder „Google Maps“ wäre nur dann möglich, wenn als Haupt-App noch immer parallel dazu die Uber-Anwendung laufen würde, denn da spielt die Musik.
Irgendwelche Tipps aus der Blog-Community?