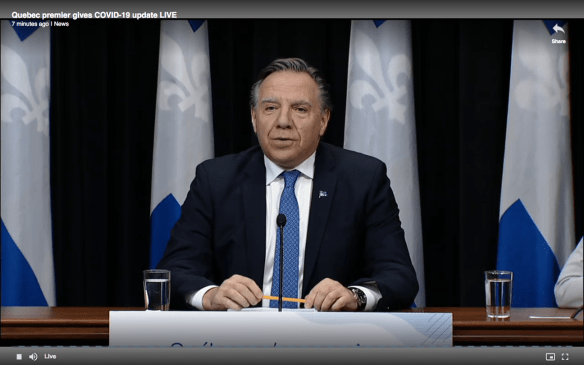Das Foto oben ist vor der Markthalle bei mir um die Ecke entstanden. Es gibt die düstere Gesamtstimmung wieder, die hier seit einigen Wochen herrscht. Und ein bisschen kann man aus dem Foto auch lesen, dass eigentlich niemand so richtig weiss, wer was darf und wer nicht. Einig ist man sich nur beim Thema Abstand halten.
Das Foto oben ist vor der Markthalle bei mir um die Ecke entstanden. Es gibt die düstere Gesamtstimmung wieder, die hier seit einigen Wochen herrscht. Und ein bisschen kann man aus dem Foto auch lesen, dass eigentlich niemand so richtig weiss, wer was darf und wer nicht. Einig ist man sich nur beim Thema Abstand halten.
Das Osteressen im Kreise von Freunden und Familien fällt flach, soviel ist schon mal klar. Aber was ist mit dem Osterspaziergang? Schön im Zwei-Meter-Abstand?
Auch verboten, ergibt die erste Recherche.
Buddelt man dann etwas tiefer auf den diversen Seiten zum Thema Corona, erfährt man: „Familien dürfen gemeinsam spazierengehen“.
Okay, dann ist ja alles gut. Bis man ein paar Klicks weiter liest: „Das gilt jedoch nur für Familien, die unter einem Dach leben“.
Also doch kein Sonntagsspaziergang mit Cassian am Alten Hafen entlang.
Der Alte Hafen, fällt mir gerade ein, liegt in einem anderen Stadtbezirk als St. Henri, wo wir unseren Lebensmittelpunkt haben. Fällt also ohnehin flach. Zu Spaziergängen ohne dringendes Ziel – also Arztbesuch, Apothekengang und Einkaufen im Supermarkt – wird allenfalls im eigenen Viertel geraten. Am besten aber bleibt man ohnehin zuhause. Hashtag stayhome eben.
Zwei Stunden nördlich von Montreal, wo unser Blockhaus steht, werden wir gleich gar nicht geduldet. Verständlich, denn in den Bergdörfern der „Laurentians“ gibt es bisher keinen einzigen Corona-Fall.
Bitte, lieber Regisseur, lass uns nicht die ersten sein, die Covid-19 dort einschleppen!
Im Nobelstadtteil Westmount, wo die Rue Sherbrooke zweispurig verläuft, dürfen Fußgänger neuerdings nur in Fahrtrichtung der Autos spazieren. Damit sollen Verstöße gegen die Zwei-Meter-Abstandsregel vermieden werden, weil Spaziergänger ja jetzt mehr Platz haben.
An der Avenue Mont-Royal dürfen Autos nur noch auf einer Fahrbahnseite parken. Die Stellplätze auf der anderen Straßenseite gehören jetzt den Fußgängern.
Empfehlungen? Regeln? Befehle gar? Keiner weiss so richtig Bescheid. Und auch das Internet, das ja bekanntlich sonst immer alles besser weiß, schweigt zu diesem Thema. Oder weiss es mal so, mal so.
Die Unsicherheit, was die Antivirus-Bestimmungen betrifft, nervt. Aus Unkenntnis gilt man schnell als „asozial“, wenn man die – in den Augen des jeweiligen Betrachters – falsche Bewegungen macht.
Also bleiben wir daheim in unseren vier Wänden, obwohl die staatlich verordnete Quarantäne längst vorbei ist. Wir beschränken uns auf einen großen Einkauf pro Woche, am besten im Supermarkt um die Ecke. Dort sind die Menschenschlangen zwar länger als im Nachbarviertel. Aber man will ja nicht gegen die Regeln verstoßen. Wenn es dann welche sind.
Verstöße werden schwer bestraft. 1000 Dollar plus $546 Bearbeitungsgebühr sind schon beim ersten Mal fällig. Für welche Vergehen gilt das nochmal?
Zwei Krankenschwestern, die im Drivethrough von McDonald’s nebeneinander in dem Auto saßen, in dem sie jeden Tag gemeinsam zur Arbeit fahren, waren eine der ersten Opfer dieser irren Zettelwirtschaft. Der Aufschrei in der Bevölkerung war groß. Aber wer will schon in Zeiten wie diesen mit Gegenklagen zusätzlich noch die Gerichte beschäftigen?
Und überhaupt: Wer mehr als eineinhalbtausend Dollar berappen kann, wo zurzeit ohnehin die meisten Menschen ohne Einkünfte sind, gehört zu den großen Geheimnissen dieser wirren Zeiten.

 Es gibt nicht viele gute Nachrichten in diesen düsteren Zeiten. Aber es gibt sie. Eine davon ist das Vorgehen der kanadischen Bundesregierung. Premierminister Justin Trudeau zeigt uns: Er ist nicht nur ein „pretty boy“ mit Tattoos und Boxer-Qualitäten. Er, der bei den meisten Kanadiern immer nur „Justin“ heißt, präsentiert sich in diesen Tagen als Staatsmann, wie wir uns keinen besseren wünschen könnten.
Es gibt nicht viele gute Nachrichten in diesen düsteren Zeiten. Aber es gibt sie. Eine davon ist das Vorgehen der kanadischen Bundesregierung. Premierminister Justin Trudeau zeigt uns: Er ist nicht nur ein „pretty boy“ mit Tattoos und Boxer-Qualitäten. Er, der bei den meisten Kanadiern immer nur „Justin“ heißt, präsentiert sich in diesen Tagen als Staatsmann, wie wir uns keinen besseren wünschen könnten.