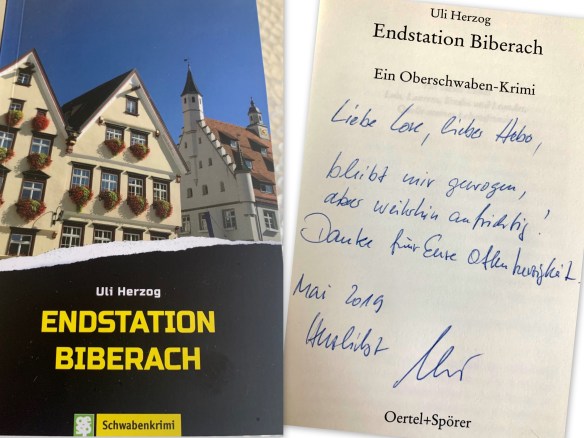Ein bisschen schwindelerregend war der Anblick schon. Da stehen Zigtausende auf dem gigantischen Platz vor der Montrealer Konzerthalle und jubeln einem Menschen zu, der dir erst neulich noch beim Frühstück in deiner Wohnung die Gitarrenakkorde von „Wish You Were Here“ beigebracht hat.
Ein bisschen schwindelerregend war der Anblick schon. Da stehen Zigtausende auf dem gigantischen Platz vor der Montrealer Konzerthalle und jubeln einem Menschen zu, der dir erst neulich noch beim Frühstück in deiner Wohnung die Gitarrenakkorde von „Wish You Were Here“ beigebracht hat.
Jetzt siehst du also diesen Menschen wegen der Entfernung zur Bühne als winzigen Stecknadelkopf Gitarre spielen und Lieder singen und es kommt so etwas wie Demut auf. Und du ertappst dich dabei, wie du dir aus Freude über den Erfolg dieses sympathischen Kerls doch tatsächlich ein paar Tränen aus den Augen reibst.
Matt Holubowski ist das, was man auf gut Deutsch einen „Shooting Star“ nennt. (Wobei sich mir der Sinn dieser Redewendung, dies nur nebenbei, nie richtig erschlossen hat. Schließlich ist ein Shooting Star eine Sternschnuppe, die von oben kommt und unten landet. Bei Matt Holubowski und all den anderen Shooting Stars der deutschsprachigen Welt ist es genau umgekehrt: Sie schossen von unten nach oben).

Klimpern auf Bopps Banjo
Matt und Cassian gingen zusammen zur Highschool. Wir wohnten damals noch imselben Dorf. Nur ein paar Grundstücke trennten unser Haus in Hudson von dem der Holubowskis. Matt und Cassian machten zusammen Hausaufgaben, hörten Musik und Podcasts und bekakelten bestimmt auch tausend Dinge, die Erwachsene nichts angehen.
Auch als sich ihre schulischen und beruflichen Wege trennten, blieben die Beiden noch immer beste Freunde. Die komplette Boy Group trifft sich noch heute jedes Jahr zu Cassians Geburtstag im Blockhaus am Lac Dufresne. Und auch sonst verlor man sich nie aus den Augen.

Dieses Selfie vom „Geheimnisverrat“ musste sein. Tatort St-Lorenz-Boulevard.
Mitte Mai, kurz nach unserer Rückkehr vom Camino, gab es eine denkwürdige Zufallsbegegnung zwischen Matt und mir. Es war ausgerechnet vor dem Montrealer Kult-Diner „Schwartz’s Delicatessen“, als ich schon aus 50 Metern Entfernung Matts lange Arme in den Himmel ragen sah. „Herbert“, rief er mir zu, „kann ich dir ein Geheimnis anvertrauen?“
Doch das mit dem „Geheimnis“ war so eine Sache. Schon bald mischten sich ein paar Teenies mit Selfie-Wünschen in unser Gespräch ein. Selbst als Montrealer passiert es eben eher selten, einem inzwischen weltweit agierenden Künstler, der übrigens schon in der Hamburger Elbphilharmonie auftrat, wie Matt Holubowksi auf der Straße zu begegnen.
Als dann noch ein Mann meines Alters mit dem Handy auf uns zukam und ein Video vorspielte, das Matt bei einem Auftritt im kanadischen Fernsehen zeigt, war klar: Dies ist nicht der Ort, um Geheimnisse auszutauschen. Also gingen Matt und ich mal kurz um die Ecke.
Er sei gebeten worden, das Abschlusskonzert des zehntägigen Jazzfestivals zu geben, verriet er mir. Ein Hammer! Er sei nervös wie ein Schulbub, sagte er. Immerhin sei seine neue CD noch längst nicht fertig und natürlich wolle so ein bis zu 150tausend Menschen umfassendes Publikum nicht nur seine alten Songs wie „Mango Tree“ oder „The King“ hören, sondern eben auch neue Töne.

Jazzfest mit Matt. ©audiogram
Beim Konzert selbst wurden dann noch unveröffentlichte Stücke ohne Namen und auch Klassiker wie „Over My Shoulder“ zum Besten gegeben, mein ganz persönliches Juwel aus Matt Holubowskis Schatzkiste.
Mit meinem Lieblingssong bin ich übrigens nicht allein. Zufällig bin ich vor ein paar Tagen auf die Playlist von David Saint-Jacques gestoßen, der erst kürzlich nach 204 Tagen von der Internationalen Weltraumstation auf die Erde zurückgekehrt ist.
Die überirdische Playlist des kanadischen Astronauten enthält also einen Song des Buben, der als Teenager noch auf meinem Banjo herumgeklimpert hat.
Hier ist „Over my Shoulder“ – zusammen mit Aliocha und Jason Bajada.