
Ich bin dann mal wieder weg. Habe Facebook und Instagram wieder einmal adieu gesagt und lebe seit zwei Tagen enthaltsam, ohne digitales Störfeuer.
Ich habe nichts gegen Facebook und auch nicht gegen Instagram. Dass es sich bei beiden um Datenkraken handelt, ist bekannt. Aber das Internet ist keine Einbahnstraße, es ist ein Geben und Nehmen. Dafür, dass mir das WorldWideWeb mit all seinen faszinierenden Facetten so unglaublich viel gibt, bin ich, mit Abstrichen, auch bereit, ein bisschen von mir preiszugeben. Wer sich entschlossen hat, öffentlich zu leben, darf sich nicht wundern, wenn seine Daten später nichtöffentlich abgegriffen werden.
Nur: Ich hatte mehr und mehr das Gefühl, dass nicht ich derjenige bin, der die Sozialen Medien kontrolliert. Sie kontrollieren mich. Viel zu viele Sommerabende habe ich am Rechner und am Handy mit Posten und Liken von Beiträgen verbracht. Oft war es schade um die schöne Zeit. Deshalb habe ich mich jetzt von Facebook & Co verabschiedet. Zumindest vorübergehend.
Eigentlich mag ich ja Facebook. Der Austausch mit Menschen, mit denen man zwar keine Brieffreundschaft unterhalten würde, die einen aber trotzdem irgendwo interessieren – das alles gefällt mir. Instagram mag ich fast noch lieber. Es ist ein „Seh“-Medium, hier werden aussagestarke, oft wunderschöne Fotos gepostet. Von Reisen und Rezepten (“foodporn“). Und, ja, auch von Katzen.
Die „Insta-Stories“, die man dort dramaturgisch geschickt aneinanderreihen kann, haben mich nie sonderlich interessiert. Aber allein die Technik, die dafür verwendet wird, fasziniert mich. Dieser Teil der digitalen Wundertüte wird mir fehlen. Aber dafür gibt es Technik-Blogs und andere Quellen.
Warum ich bei all der Begeisterung dann trotzdem abgesprungen bin? Weil es mir unheimlich geworden ist, wie zeitintensiv die Pflege von „Freundschaften“ bei den Sozialen Medien ist. Mein angeborener Voyeurismus verbietet es mir, bei von Freunden veröffentlichten Posts einfach weiterzuscrollen. Ich habe jede Zeile von ihnen gelesen, jedes Foto angeschaut, jeden Link angeklickt und die Geschichte, die sich dahinter aufbaut – meistens – gelesen. Und das bei mehr als 300 „Friends“.
Nur mit „Memes“ konnte ich nie viel anfangen. Das sind diese Grafiken mit einer Bildunterschrift, die oft aus einem Zitat bestehen, das Menschen zugeschrieben wird, die das womöglich gar nicht so gesagt haben. Mit anderen Worten: Fake News.
Witzig fand ich bei Instagram all die kuriosen Hashtags. Das sind jene mit einem Kreuzchen versehenen Stichworte, die sich dann, wie bei einem Link, anklicken lassen. Hinter diesem Hashtag findet man dann gebündelt Meinungen, Bilder, Videos oder auch echte Links zum jeweiligen Thema.
Wie lange meine Abstinenz von Facebook und Instagram dauern wird, oder ob sie diesmal wirklich endgültig ist, kann ich nicht sagen. Im Moment schaue ich mir noch gebannt bei der Entwöhnungsphase zu. So ungefähr muss es einem Alkoholiker auf Entzug gehen.
Übrigens: Ich mag meine Facebook-Freunde noch immer, auch wenn ich sie künftig nicht mehr liken werde.

 Es gab Zeiten, da habe ich mindestens zweimal pro Jahr im ARD-Hörfunk über Kältewellen in Kanada berichtet. Zum Beispiel darüber, wie man sich bei minus 40 Grad am besten kleidet und auch, was Inuit-Mütter tun, um ihre Kinder vor dem Erfrieren zu bewahren. Von einer Hitzewelle, wie sie schon sei Tagen in Montreal herrscht, konnte ich nie berichten. Bietet sich also an, es hier zu tun.
Es gab Zeiten, da habe ich mindestens zweimal pro Jahr im ARD-Hörfunk über Kältewellen in Kanada berichtet. Zum Beispiel darüber, wie man sich bei minus 40 Grad am besten kleidet und auch, was Inuit-Mütter tun, um ihre Kinder vor dem Erfrieren zu bewahren. Von einer Hitzewelle, wie sie schon sei Tagen in Montreal herrscht, konnte ich nie berichten. Bietet sich also an, es hier zu tun. warum nicht?, ein T-Shirt direkt aus dem Gefrierschrank. Eisbeutel im Baseballkäppi? Eher nicht.
warum nicht?, ein T-Shirt direkt aus dem Gefrierschrank. Eisbeutel im Baseballkäppi? Eher nicht.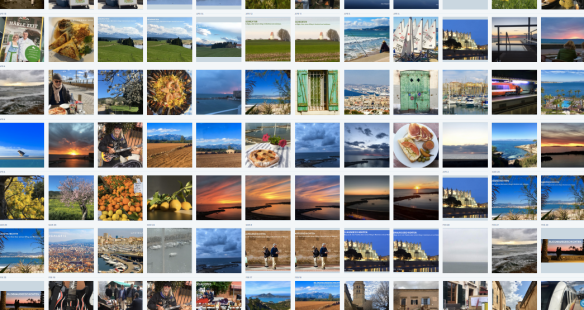 Ich weiß nicht, wie es auf ihrem Rechner, ihrem Tablet oder Smartphone aussieht. Ich weiß nur: So langsam ertrinke ich in einer Flut von Bildern. Genau 30.000 sind es in diesem Moment. Dazu ein paar Dutzend Videos – macht zusammen ein Bildermeer, das kaum mehr zu navigieren ist.
Ich weiß nicht, wie es auf ihrem Rechner, ihrem Tablet oder Smartphone aussieht. Ich weiß nur: So langsam ertrinke ich in einer Flut von Bildern. Genau 30.000 sind es in diesem Moment. Dazu ein paar Dutzend Videos – macht zusammen ein Bildermeer, das kaum mehr zu navigieren ist.

