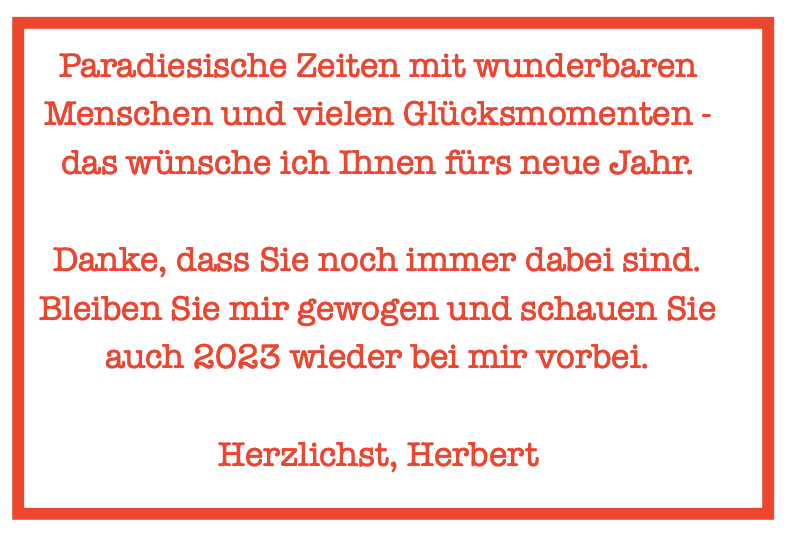Mit einer Wandergitarre fing alles an. Um dieses wunderschöne Instrument mit seinen kunstvollen Perlmutt-Intarsien ranken sich viele Geschichten. Mal hieß es, Vater hätte die Klampfe von einem spanischen Orgelbauer abgekauft, der auf Arbeitssuche war und zufällig durch Ummendorf wanderte. Ein andermal wurde kolportiert, sie sei im Tauschverfahren bei uns gelandet. Jedenfalls war diese Gitarre Teil unseres Haushalts, so lange ich denken kann.
Die Wandergitarre ist dort geblieben, wo sie hingehört: In meinem Elternhaus in Ummendorf.
Es sollte nur die erste von vielen Gitarren sein, die mich auf meinem Leben begleiteten. Als Gitarrist bei den “Outlaws”, der damals todsicher härtesten Rockband östlich von Liverpool, musste es eine Elektrogitarre sein – eine “Framus” mit einem atemberaubend schönen Klangkörper.
Es folgten eine “Yamaha”, eine “Hofner”, eine “Fender” und schließlich eine in Montreal handgeschreinerte Akustik-Gitarre der Marke “Seagull”.
Zwischendurch nannte ich auch eine zwölfsaitige Gitarre mein eigen – ein herrlich-herausforderndes Instrument. Zwölf Saiten müssen laufend nachgestimmt werden, auch während des Spiels. Das, so fand ich, kann ziemlich spaßbremsend sein. Als Straßenmusiker leistete sie mir jedoch gute Dienste, verschaffte mir stets Gehör und brachte mir so manchen Taler ein.

Heute kommt nun eine weitere Gitarre dazu, eine mattschwarze “Vangoa”. Eine junge Französin bot sie im Internet an. Sie besitze das Instrument erst seit einem Monat, erzählte sie mir beim Abholen. Jetzt trenne sie sich wieder von ihm, weil ihr Freund sie zu Weihnachten mit einer qualitativ hochwertigeren Gitarre beschenkt habe.
Die Neue darf in der Stadt bleiben, die anderen kommen aufs Land. Im Blockhaus schlummert derweil noh eine antike Mandoline vor sich hin.
Aber in der Stadt geht musikalisch die Post ab. Dort wartet noch ein ziemlich vorlautes Banjo darauf, von seinem Herrchen liebevoll wachgezupft, manchmal aber auch geschlagen zu werden.
Es ist nicht das erste Banjo, das ich besitze.
Das Erste war ein ziemlich mitgenommenes Stück, das ich in den 70er-Jahren mit einem Redaktions-Kollegen in Wablingen gegen eine Super-8-Filmkamera eingetauscht hatte. Ein großer Fehler! Es verging kein Tag, an dem ich das scheppernde Saiteninstrument nicht vermisst hätte.

Gestillt wurde meine Sehnsucht dann ein Vierteljahrhundert später bei einem Weinfest im Remstal, zu dem ich aus Kanada angereist war. Der inzwischen in die Jahre gekommene Tausch-Kollege von damals hatte keine Verwendung mehr für das gute Stück und gab es mir zu meiner unfassbar großen Freude zurück.
Heute darf sich das Banjo im Blockhaus von den zahlreichen Händen ausruhen, durch die es gegangen ist – und auch von einigen Reisen.
Auf einer dieser Reisen per Anhalter durch Europa hatte mir ein gewisser “Donovan” bei einer gemeinsamen Jam-Session in Italien ein Autogramm aufs Fell gekritzelt. Die Unterschrift war später dem Reinigungsdrang einer schwäbischen Hausfrau zum Opfer gefallen, der Ehepartnerin des Tausch-Kollegen. Sie hatte Donovans Schriftzug – warum auch immer – fein säuberlich mit Bürste und Seife entfernt.
Wie konnte sie auch wissen, dass es sich bei der Unterschrift um eine Widmung jenes Donovan handelte, der später unter anderem mit Welthits wie „Mellow Yellow“ und „Colours“ Millionen von Schallplatten verkaufte?