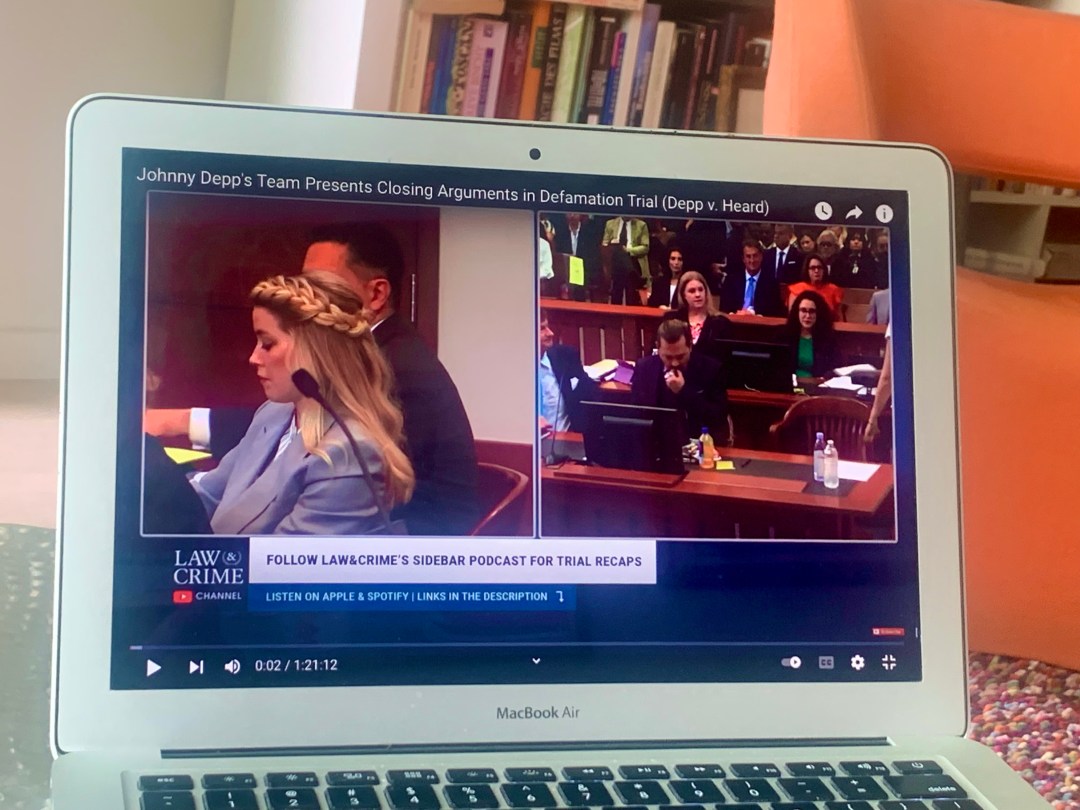Kritik an einer Gesellschaft zu üben, die einem seit fast 40 Jahren ein Zuhause bietet, ist ein Drahtseilakt, der leicht zum Absturz führen kann. Deshalb will ich versuchen, es so zu formulieren, dass niemand die Balance verliert: Die Politik in Quebec stinkt zum Himmel. Der Irrsinn, der hier mit der Rettung der angeblich vom Aussterben bedrohten französischen Sprache betrieben wird, muss gestoppt werden. Aber wie?
Was hier zurzeit abläuft, hat mit einer offenen kanadischen Gesellschaft nichts mehr zu tun. Es ist, wie es ein Freund formulierte, der Land und Leute gut kennt, “menschenfeindlicher Rassismus unter dem Deckmantel angeblicher Minderheiteninteressen”. Im Grunde seien das, so meint der befreundete Kollege, „Apartheidsgesetze“.
Was ist passiert?
Nichts ist passiert. Und genau das ist das Problem.
Das Zusammenleben zwischen einer französischsprachigen Mehrheit und einer englisch- und anderssprachigen Minderheit hat über viele Jahre wunderbar funktioniert.
Doch jetzt, wenige Monate vor den Landtagswahlen in Quebec, spielt Ministerpräsident François Legault den starken Mann. Er entzieht der nicht Französisch sprechenden Minderheit per Gesetz Rechte, die eigentlich selbstverständlich sein sollten. Mit der “Bill 96” tritt er, der eigentlich vermitteln sollte, als Spalter vom Dienst auf.
🔵 Auch wenn es der zuständige Minister anders, schwammiger formuliert: Ärzte und Krankenschwestern sind angehalten, Französisch mit ihren Patienten zu sprechen. Ausnahme: Bewohner der Provinz, die „historisch anglophon“ sind, wie die Bestimmung besagt.
🔵 Richter müssen künftig nicht mehr zweisprachig sein. Französisch allein genügt.
🔵 Neueinwanderer müssen mit den Quebecker Behörden bereits sechs Monate nach ihrer Ankunft auf Französisch korrespondieren, sonst riskieren sie, dass ihre Anträge nicht bearbeitet werden.
So weit, so schlecht.
Der schwerwiegendste Eingriff in die demokratische Verfassung eines Landes kann bestenfalls mit dreist beschrieben werden, schlimmstenfalls mit Stasi-Methoden:
🔵 Die Quebecker Sprachenpolizei („l’office de la langue française“) hat das Recht, ohne Voranmeldung, ohne Durchsuchungsbefehl und ohne ersichtlichen Grund Computer und Handys von Firmen mit mehr als 50 Beschäftigten einzusehen. Die geschäftliche Korrespondenz muss, wo irgendwo nur möglich, auf Französisch geführt werden.
Ein eigen dafür gegründetes Ministerium wird die Überwachung dieser (vermutlich höchst rechtswidrigen) Bestimmungen übernehmen.
Schon jetzt steht eine Armee von Anwälten in den Startlöchern, um das neue ”Gesetz 96” anzufechten bzw. zu verteidigen. Dabei werden Gelder verschwendet, die dringend anderweitig benötigt werden. Allen voran auf dem Gesundheitssektor.
🔵Die Wartezeiten für Hüftoperationen betragen zwei Jahre und mehr. Selbst bei schmerzlindernden Cortison-Injektionen muss mit einer monatelangen Wartezeit gerechnet werden.
🔵 Wartezeiten von sieben bis neun Stunden sind in den Notaufnahmen der Krankenhäusern eher die Regel als die Ausnahme.
🔵 Zwei Millionen Quebecker finden keinen Hausarzt.
🔵 Wer in die Röhre muss, wartet monatelang, manchmal ein Jahr und mehr auf einen Termin.
🔵 Nirgends in Kanada sind auf die Bevölkerungszahl gerechnet mehr Menschen an Covid gestorben als in Quebec. Behörden und Krankenhäuser waren mit dem Management der Pandemie schlicht überfordert.
Die Liste könnte fortgesetzt werden.
Und jetzt also ein Ministerium zur Erhaltung der französischen Sprache.
Die Angst, im Meer der englischsprachigen Sünde zu versinken, treibt die amtierende nationalistische, rechts-konservative “Coalition Avenir Québec” (CAQ) unter ihrem Ministerpräsidenten François Legault zu Maßnahmen, die selbst bei französischsprachigen Medien Kopfschütteln verursachen.
François Legault habe aus rein machtpolitischen Interessen eine Krise heraufbeschworen, die keine ist, heißt es in “La Presse”.

Geradezu lächerlich macht sich der Regierungschef mit der jetzt geäußerten Befürchtung, Quebec könne “zu einem Louisiana” werden.
In dem US-Südstaat, der im 17. Jahrhundert im Namen des Königs von Frankreich kolonialisiert worden war, sprechen lediglich noch 2 Prozent der Bevölkerung Französisch. In Quebec sind es pralle 90 Prozent.
Eine vom Aussterben bedrohte Sprache sieht anders aus.
Fakt ist: Vor den Wahlen im Oktober will François Legault den starken Mann spielen. Dabei hat er dies gar nicht nötig. Meinungsumfragen zufolge wird die Regierungspartei CAQ ohnehin haushoch gewinnen.
In der Metropole Montreal wird François Legault mit seiner nationalistisch geprägten, fremdenfeindlichen Politik der Ausgrenzung weniger Unterstützung finden als auf dem Land. Seine Partei spricht vor allem die Bewohner der provinziell geprägten Regionen Quebecs an. Dort ist die CAQ-Basis gut verankert.
Auch Einwanderern will es Legault erschweren, sich in Englisch – und gleich gar nicht in ihrer Muttersprache – einzuleben. Er will der kanadischen Bundesregierung das Mitspracherecht bei der Bewilligung von Einwanderungs-Anträgen entziehen.
Wohin das führen würde, ist klar. Anwärter aus englischsprachigen Herkunftsländern müssten sich warm anziehen.
Ein Glück, dass Kanada, anders als die Provinz Quebec, ein Staat ist, der Toleranz und Inklusion nicht nur predigt, sondern Versprechen auch mit Taten unterfüttert.
Die Antwort von Premierminister Justin Trudeau auf Legaults Anliegen fiel deutlich aus. Der Provinz Quebec die alleinige Entscheidung bei der Rekrutierung von Einwanderern zu überlassen, komme nicht infrage.
Ein Lichtblick in dunklen Zeiten.
Und noch ein Lichtblick: Bei einer Demonstration ließ die großartige Quebecker Schriftstellerin Louise Penny vor einigen Tagen ein Manifest verlesen. Hier ist es im Wortlaut:
„I live in Quebec by choice. It’s my home. My books are love letters to this part of Canada. I will absolutely fight to protect the French language and rich culture. I do it all day, everyday, in my books – where I talk about the Quebec I know and love. One of acceptance, of tolerance, where Anglos and Francophones sometimes disagree, where there are misunderstandings, tensions, and lively political discourse. And then we sit down and have a meal together.

That is the Quebec I live in and see everyday. One where there is respect for what each brings, and has brought, to life in this province. But Bill 96 is now telling me my right to health-care, education, access to the courts in my own language will be limited. Bill 96 solves a „problem“ that does not exist. It takes a hammer to a situation when, if adjustments are necessary, a tweezer would do. I don’t understand how politicians who would be rightly infuriated if it was done to them, can do it to others.
I love Quebec. My parents were born here. My husband was born, raised, worked here all his life and his ashes are scattered here. This is our home. I am Anglophone. I am a Quebecker.“