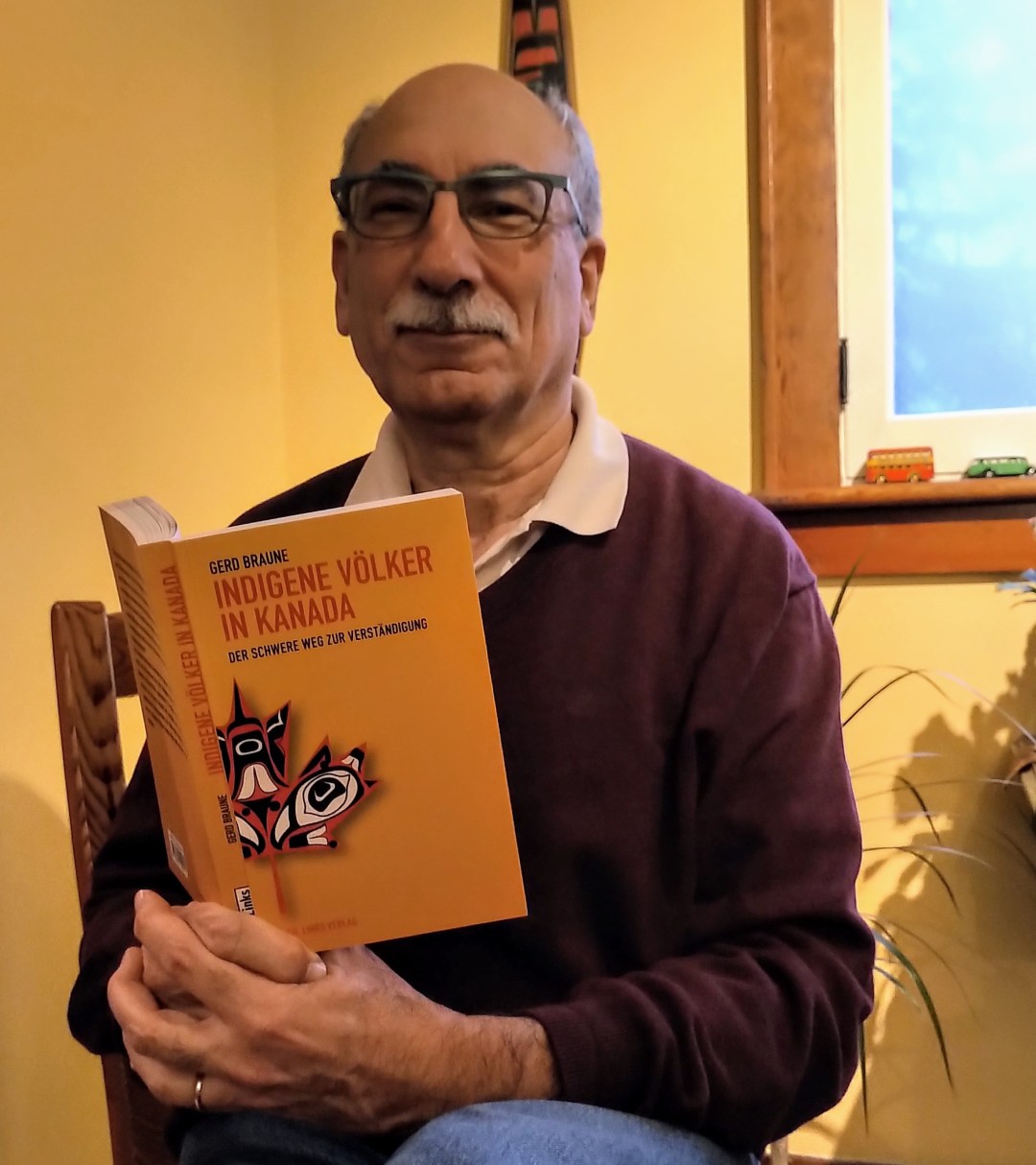Die Idee ist nicht ganz neu, aber hübsch ist sie trotzdem: Menschen ziehen sich aus für einen guten Zweck. In diesem Fall sind sie selbst der gute Zweck. Mit einer „Mach-dich-nackig“-Aktion in der Quebecer Kleinstadt Lac-Mégantic werben die BesitzerInnen lokaler Geschäfte dafür, in Zeiten wie diesen ihre Läden beim Einkauf nicht zu vergessen.
Der Fotograf Claude hatte von der Corona bedingten Idee in seinem Heimatland Frankreich gehört. Dort hatten Geschäftsleute für eine Werbekampagne zum Thema „shop local“ viel nackte Haut gezeigt. „Pour qu’on ne finisse pas tous a poil„, heißt die Aktion. Etwa: „Damit wir hinterher nicht alle nackt dastehen“.
„Er rief eines morgens bei mir an“, erinnert sich Audrey vom lokalen Nagelstudio, ob ich mich für ihn ausziehen würde. Erst habe sie gedacht, der Typ spinnt, erzählte Audrey dem lokalen Radiosender. Als der nicht mehr ganz junge Fotograf der Frau schließlich die Hintergründe seines Vorstoßes verklickert hatte, willigte sie jedoch ein.
Audrey und noch weitere zwölf Männer und Frauen fanden sich nach und nach zum Fotoshooting bei Claude ein. Einige ließen sich nur in Unterwäsche ablichten, bei manchen durfte es ein bisschen mehr sein. So scheute sich der Initiator der PR-Aktion nicht, sich selbst ganz und gar nackig zu machen.
Bisher war die Reaktion auf die Aktion ausgesprochen positiv, sagt Claude. Von der Autowaschanlage über die Blumenhändlerin bis zum Computershop – sie alle berichten von mehr Kundenverkehr.
Dass sich darunter auch einige „Seh-Leute“ befinden, ist jedoch nicht auszuschließen. Motto: „Wie sieht die Nackte wohl bekleidet aus?“