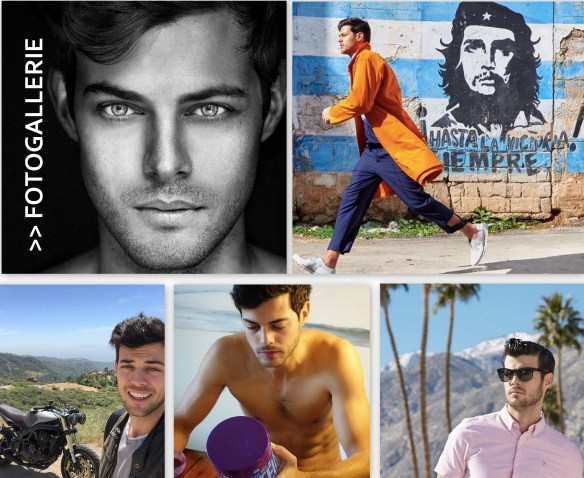Viel zu feiern gibt es nicht, in diesen tristen Trump-Tagen in Amerika. Bis vor ein paar Stunden. Da zauberte mir ein Fernseh-Event ein Lächeln ins Gesicht. David Letterman ist wieder da! Der legendäre Talkmaster, der im Sommer 2015 nach mehr als 30 Jahren seine „Late Show“ geschmissen hatte, ist ins Fernsehen zurück gekehrt.
Viel zu feiern gibt es nicht, in diesen tristen Trump-Tagen in Amerika. Bis vor ein paar Stunden. Da zauberte mir ein Fernseh-Event ein Lächeln ins Gesicht. David Letterman ist wieder da! Der legendäre Talkmaster, der im Sommer 2015 nach mehr als 30 Jahren seine „Late Show“ geschmissen hatte, ist ins Fernsehen zurück gekehrt.
Auf NETFLIX konnte man ihn jetzt zum ersten mal wieder sehen. Der Titel seiner Show ist denn auch Programm: „My next Guest needs no Introduction“. Lettermans erster Gast war Barack Obama.
Ernster ist „Dave“ geworden, wie ihn seine Fans nennen, älter natürlich auch. Ein biblischer Bart verdeckt das Gesicht. Die lustige Zahnlücke, sein Markenzeichen, ist nur schwer hinter dem grauen Gestrüpp ausfindig zu machen ist. Eine Stunde reden der ehemalige Latenight-König und der Ex-Präsident über Ehefrauen, Urlaubsorte und Kinder. Aber auch ganz viel über Politik.
Auch wenn der Name des trotteligen Trump nicht ein einziges Mal fiel, war doch permanent von ihm die Rede. Von seiner Gemeinheit, seiner Dummheit und auch davon, wie es ein einziger Mensch schaffen kann, eine ehemals stolze Nation wie Amerika der Lächerlichkeit preiszugeben.
Für mich war die gestrige Sendung ein Wiedersehen mit einem Mann, der mir nach meiner Ankunft in Kanada zahllose Fernsehabende verschönt hatte.
Anders als der große Johnny Carson, der sich in seiner „Tonight Show“ gerne selbst zelebrierte, ging Letterman Dingen auf den Grund, die man einfach wissen musste, um mitreden zu können, wenn man in Nordamerika lebte.
So war nie zuvor einer auf die Idee gekommen, vor einem Millionenpublikum zu testen, ob ein Sixpack Cola-Light tatsächlich leichter sei als eine Sechserpackung Cola-Classic. Was lag da näher als zu später Stunde eine Kiste Coladosen vom Empire State Buildung auf die Strasse knallen zu lassen? Surprise, surprise: Die Light-Version brauchte auch nicht länger als die klassische.
Dann kam der 11. September 2001.
„Dave“ war der erste unter den amerikanischen Comedians, der sich nach den Teroranschlägen wieder ins Fernsehen wagte. „Warum nicht?“, sagte er sieben Tage nach 9/11. „Amerika hat das Lachen doch nicht etwa verlernt“?

September 2001: Der Autor am Ed Sullivan Theatre zur ersten Letterman-Show nach 9/11
Von der ersten Reihe des Ed Sullivan Theatre aus, in dem viele Jahre zuvor der Grundstein für den Siegeszug der Beatles durch Amerika gelegt worden war, wurde ich am Abend des 18. Septembers 2001 Zeuge des vielleicht schwierigsten Auftritts David Lettermans.
„Tun Sie uns einen Gefallen“, hatte die Platzanweiserin vor der Show in die wartende Menge gerufen, „klatschen Sie heute besonders heftig. Dave braucht das zur Zeit.“
Faszinierend der erste Studiogast: ABC-Korrespondent John Miller. Er ist der letzte Journalist – und einer der ganz wenigen überhaupt – der Osama Bin Laden fürs Fernsehen interviewt hat. Auf dem Weg zu Bin Ladens verstecktem Camp sei ihm aufgefallen, in welch schlechtem Zustand die Zufahrt zum Haus des mutmaßlichen Drahtziehers der jüngsten Terroranschläge gewesen sei.
Umso erstaunlicher, als Bin Ladens Familie ihr Vermögen doch im Baugeschäft gemacht hat“. Letterman zu Miller: „Haben sie noch Kontakt mit dem Mann?“. Miller: „Nein“. Letterman: „Sie meinen, er hat Ihnen nicht seine Visitenkarte zugesteckt?“
Als NETFLIX gestern die Neuauflage der legendären Letterman-Show ins Fernsehen hievte, gab es keine Tränen. Da saßen zwei ältere Herren auf der Bühne, die irgendwann plötzlich keinen Job mehr hatten. Es wurde gefeixt und geplappert und munter drauf los erzählt. Und schon bald herrschte eine Fröhlichkeit im Studio, wie man sie schon lange nicht mehr erlebt hatte, in diesem politisch tristen Amerika.
Ein Ex-Präsident, der komplette Sätze reden konnte und mit einer rhetorischen Leichtigkeit für Tiefgang sorgte, wie man ihn aus Washington nicht mehr gewöhnt ist. Und ein Ex-Talkshow-Host, der trotz seiner 70 Jahre diese frische Brise durch den Bildschirm schickt, für die wir ihn alle so liebten.
Das Schönste: Weit und breit kein rassistischer Tölpel, der Amerikas guten Ruf auf dem Gewissen hat.