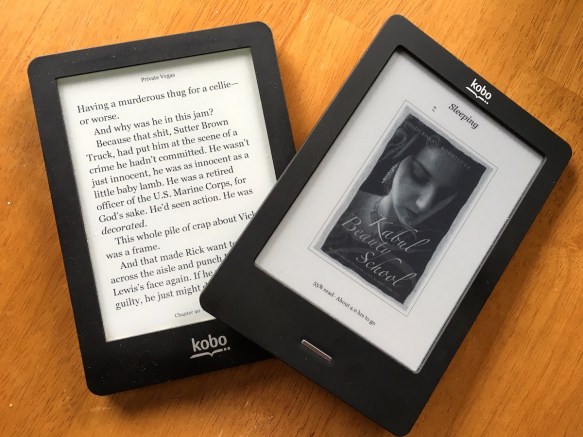Als gegen 22 Uhr in der „Atomic Bar“ die Bombe platzte, war klar: Mein erster Wunsch war in Erfüllung gegangen. Die düsteren Zeiten unter dem stockkonservativen Premierminister Stephen Harper sind vorbei. An seine Stelle tritt ein cooler, kluger, liberaler Kopf: Justin Trudeau (43), Sohn des legendären Premierministers Pierre Elliot Trudeau. Was aber würde aus unserer Freundin Marjolaine werden, zu deren Wahlparty ich in den tiefen Osten der Stadt gereist war?
Als gegen 22 Uhr in der „Atomic Bar“ die Bombe platzte, war klar: Mein erster Wunsch war in Erfüllung gegangen. Die düsteren Zeiten unter dem stockkonservativen Premierminister Stephen Harper sind vorbei. An seine Stelle tritt ein cooler, kluger, liberaler Kopf: Justin Trudeau (43), Sohn des legendären Premierministers Pierre Elliot Trudeau. Was aber würde aus unserer Freundin Marjolaine werden, zu deren Wahlparty ich in den tiefen Osten der Stadt gereist war?
Das Schöne an Freundschaften ist, dass man nicht dieselbe Partei wählen muss, aber trotzdem für einander da ist, wenn Not an der Frau ist. Was haben wir Plakate geklebt, Flyers verteilt, Werbung gemacht bei Freunden und Bekannten! Nicht für die Partei. Aber für Marjolaine als Kandidatin.
Marjolaine Boutin-Sweet sitzt seit vier Jahren als Abgeordnete für die links-demokratische NDP im Bundesparlament in Ottawa. Die Partei gefällt mir gut, ihr Spitzenkandidat weniger. Hätte die NDP die gestrige Wahl gewonnen, wäre Tom Mulcair Premierminister geworden. Er wäre meine zweite Wahl gewesen. Alle, nur nicht Harper.
Aber weil Marjolaine unsere Freundin ist und sie während des Wahlkampfs gekämpft hat wie eine Löwin, galten meine gedrückten Daumen ihr, als es um die Besetzung des Wahlkreises Hochelaga ging. Es sah nicht gut aus. Die liberale Gegenkandidatin war mal um 200 Stimmen voraus, dann lag sie wieder um 22 Stimmen zurück. So ging das den ganzen Abend bis spät in die Nacht.
In der „Atomic Bar“ herrschte so etwas wie Endzeitstimmung. Den Ausgang kannte bis zum Schluss keiner. Also wurde vor der Riesenleinwand geklatscht und gebuht, gewettert und diskutiert. Und immer, wie das unter Québecern so Usus ist, gegessen und getrunken. Auch einige „Fuck Harper“-T-Shirts waren zu sehen.
Kurz nach Mitternacht stand das Ergebnis immer noch nicht fest. Aber die letzte U-Bahn wartet nicht auf einen, der wissen will, wieviele Stimmen seine Freundin bekommen hat. Also hiess es für mich gegen ein Uhr morgens Tschüss zu sagen: Zu Marjolaine, zur „Atomic Bar“ und zu all denen, die dort noch bleiben konnten, weil keine U-Bahn auf sie wartete.
Das Wlan in der Métro ist eine einzige Ruckelpartie. Ein zuverlässiges Resultate-Checken im Internet war nicht möglich. Beim Aussteigen an meiner Haltestelle ein Blick aufs Handy: Marjolaine hatte mit 362 Stimmen die Nase vorn. Beim Aufschließen der Wohnungstür entwich mir ein kleiner Seufzer: Jetzt war unsere Freundin nicht mehr einzuholen.
Sie hat gewonnen! Ihren Sitz als NDP-Abgeordnete für den Wahlbezirk Hochelaga konnte sie erfolgreich verteidigen. Mit einem Stimmenunterschied von gerade mal 461.
Félicitations, Marjolaine! Good Luck, Justin!