So fühlt es sich also an, wenn man mit 63 die erste Filmrolle seines Lebens bekommt und demnächst vor der Kamera steht. Gleich kommt der Fahrer. Dann geht es in die Berge, nördlich von Montreal. Dort wird bereits seit einer Woche gedreht. Mein Charakter kommt erst ab Montag im Film vor. Vier Tage diese Woche, drei in der darauffolgenden – so sieht der Drehplan aus. Und ich bin nervös wie ein Teenager vor dem ersten Date.
„Kein Grund zur Nervosität“, beschwichtigt mich Sterling am Telefon. Er ist der Regisseur von „Belle“. Sterling muss es wissen. Er hat schon einige Indie-Produktionen hinter sich. Ein richtiger Kassenhit war nicht darunter, aber schöne, ästhetische Filme über die unterschiedlichsten Themen sind unter seiner Regie entstanden, von Ruanda bis zum Rappermovie. Einer seiner Kunstfilme wurde im New-Yorker Guggenheim-Museum gezeigt.
„Belle“ ist ein Film im Film
 „Belle“ ist nichts von alledem. Es ist ein Film im Film. Ein Kinofilm, der die Geschichte eines älteren Mannes (Theodore) erzählt, der sich bei Dreharbeiten in eine blutjunge Schauspielerin verliebt und dabei an den Folgen von so etwas wie Altersrassismus zu leiden hat. Vor allem ein Kollege am Set macht sich gerne lustig über den älteren Herrn, für den das Leben seit der Begegnung mit der jungen Schauspielerin „Mae“ erst richtig anzufangen scheint. Und das mit 62 Jahren.
„Belle“ ist nichts von alledem. Es ist ein Film im Film. Ein Kinofilm, der die Geschichte eines älteren Mannes (Theodore) erzählt, der sich bei Dreharbeiten in eine blutjunge Schauspielerin verliebt und dabei an den Folgen von so etwas wie Altersrassismus zu leiden hat. Vor allem ein Kollege am Set macht sich gerne lustig über den älteren Herrn, für den das Leben seit der Begegnung mit der jungen Schauspielerin „Mae“ erst richtig anzufangen scheint. Und das mit 62 Jahren.
Ursprünglich war ich für die Rolle des Theodore gecastet worden. Aber der Regisseur hatte Erbarmen mit dem neugierigen, aber Film-unerfahrenen Journalisten, der zwar hinter der Kamera gearbeitet hat, niemals aber davor. Jetzt ist die Rolle mit einem routinierten Schauspieler besetzt. Und das ist gut so.
Manchmal haut Waldemar auf den Tisch
Es wurde neu gecastet. Meine Rolle ist jetzt die des Regisseurs des Films im Film. Waldemar, ein deutscher Filmemacher mit europäischem Akzent, älter, erfahren, cool, aber dennoch freundlich, das Ganze mit dem Touch des Bohemiens. Waldemar hat das Wort am Set. Aber er ist mehr als ein Regisseur. Er vermittelt, strahlt Ruhe aus. Und wenn es mal zu sehr knistert zwischen der jungen Mae und dem alten Theodore, haut Waldemar auch mal auf den Tisch.
Es ist viel Text, den ich zu lernen hatte, zu viel eigentlich für Einen, der als Hörfunkkorrespondent ein Leben lang frei von der Leber sprechen durfte. Das Script, sagt Sterling, sei nur die Vorlage. Ich solle mir die Dialoge „mundgerecht“ machen. Wegen der Authentizität. Das werde ich gerne tun. Wer sagt denn schon „would it be a bother“ wenn „would you mind“ viel flüssiger klingt?
Leben und arbeiten in der Lodge
Schauspieler, Regisseur und Crew wohnen dort, wo gedreht wird: In einer wunderschönen Lodge an einem See in der bergigen Landschaft der Laurentiden. Der Indian Summer ist dort vorbei. Vor ein paar Tagen fiel der erste Schnee. Es gibt Szenen am Kamin, im Wald und auch in einem Ruderboot im See. Und, ja, es gibt auch erotische Szenen in „Belle“. Aber es ist in erster Linie ein vertrackter Beziehungsfilm mit ein bisschen verbotener Liebe und schönen Bildern.
Während der Dreharbeiten darf nicht fotografiert werden. Aber ich werde versuchen, hier im Blog ab und zu meine Eindrücke niederzuschreiben.
Dann also bis demnächst in diesem Theater.




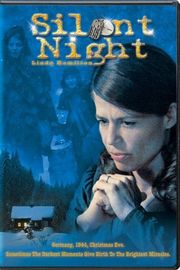


 Die Hutterer haben eine tragische Geschichte hinter sich. Als ihr Gründer Jakob Hutter 1536 wegen seines Glaubens in Innsbruck hingerichtet wurde, machten sich seine Anhänger auf eine Odyssee, die sie in viele Teile der Welt führte. Zunächst verteilten sie sich in Europa. Vor etwa 160 Jahren ließen sie sich dann in Kanada nieder. Die USA wären ihnen auch recht gewesen. Aber als Pazifisten würden sie nie in den Krieg ziehen. Es sind im christlichen Sinne Kommunisten, die nach dem Motto leben: „Jeder gibt, wos’r kann und kriegt wos ihm not ist.“ So einfach ist das. Es ist ein fast vergessenes Volk, das Privateigentum schon 300 Jahre vor Karl Marx abgeschafft hat. Ihre Sprache ist für uns schwer verständlich. Es ist eine Mischung aus Tirolerisch/Kärntnerisch/Deutsch, mit vielen englischen Brocken dazwischen.
Die Hutterer haben eine tragische Geschichte hinter sich. Als ihr Gründer Jakob Hutter 1536 wegen seines Glaubens in Innsbruck hingerichtet wurde, machten sich seine Anhänger auf eine Odyssee, die sie in viele Teile der Welt führte. Zunächst verteilten sie sich in Europa. Vor etwa 160 Jahren ließen sie sich dann in Kanada nieder. Die USA wären ihnen auch recht gewesen. Aber als Pazifisten würden sie nie in den Krieg ziehen. Es sind im christlichen Sinne Kommunisten, die nach dem Motto leben: „Jeder gibt, wos’r kann und kriegt wos ihm not ist.“ So einfach ist das. Es ist ein fast vergessenes Volk, das Privateigentum schon 300 Jahre vor Karl Marx abgeschafft hat. Ihre Sprache ist für uns schwer verständlich. Es ist eine Mischung aus Tirolerisch/Kärntnerisch/Deutsch, mit vielen englischen Brocken dazwischen.