Die Sprachenpolizei der frankokanadischen Provinz Québec zieht mal wieder die Daumenschraube an. Rein englische Firmenbezeichnungen werden nicht länger geduldet. Die Befürchtung: Französisch als Amtssprache könnte im Meer der englischsprachigen Sünde aussterben.
 Ich liebe Französisch. Und ich wünschte, ich würde es genau so fließend sprechen und schreiben wie Englisch oder Deutsch. Aber ich habe lange in einem rein englischsprachigen Umfeld gelebt und bin aus der Übung gekommen. Jetzt klingt mein Französisch zwar noch nicht ganz wie Polnisch rückwärts. Aber an der Sorbonne vermutet man mich jetzt auch nicht gerade. Es gibt also, rein sprachlich gesehen, Steigerungsmöglichkeiten. Vor allem nach oben.
Ich liebe Französisch. Und ich wünschte, ich würde es genau so fließend sprechen und schreiben wie Englisch oder Deutsch. Aber ich habe lange in einem rein englischsprachigen Umfeld gelebt und bin aus der Übung gekommen. Jetzt klingt mein Französisch zwar noch nicht ganz wie Polnisch rückwärts. Aber an der Sorbonne vermutet man mich jetzt auch nicht gerade. Es gibt also, rein sprachlich gesehen, Steigerungsmöglichkeiten. Vor allem nach oben.
Wir Schwabo-Kanadier können sogar Hochdeutsch

Sprachenpolizistin Marchant
In unserem Haus werden drei Sprachen gesprochen. Deutsch, wenn ich mit Lore und dem Sohnemann alleine bin. Englisch wenn auch nur eine Person im Raum ist, die der deutschen Sprache nicht mächtig ist. Französisch, zumindest so gut es geht, wenn wir Gäste haben, die weder Englisch noch Deutsch können. Lässt man Schwäbischschwätze auch noch als Fremdsprache durch, sind wir quadrilingual, Aber im Gegensatz zu den meisten Schwaben, können wir alles und noch Hochdeutsch dazu. Wer jedoch nur Koreanisch oder Finnisch spricht, hat bei uns Pech gehabt. Wir sind hier schließlich nicht das Goethe-Institut.
Sie merken, worauf ich hinaus möchte: Jeder trägt sein Scherflein dazu bei, es dem Anderen in diesem Sprachengewirr recht zu machen. Es gehört in Québec nun mal zum Alltag. Das ist nicht immer ganz einfach. Aber, wie mein Uraltkumpel Börnie von der Allgäu-Ranch immer sagt: „Man gewöhnt sich an allem, nur nicht an dem Dativ.“

Strafbar: Apostroph
Keine Gnade mit dem Apostroph
Ganz so lustig wie es klingt, ist dies alles nicht. Es gibt hier nämlich Gesetze, die den Gebrauch von Sprachen vorschreiben. Um die Einhaltung dieser Gesetze kümmert sich eine Behörde mit dem schönen Namen l‘Office québécois de la langue française. Unter Anglokanadiern als „language police“ bekannt.
Statt „Hudson’s Bay Company“: „La Baie“

"La Baie" statt "The Bay"
Oberste Sprachenpolizistin ist eine sehr blonde und sehr unlustige Frau namens Louise Marchand. Madame beliebt nicht zu scherzen. Sie hat jetzt erneut an Firmenbetreiber in Québec appelliert, auf die Einhaltung der Sprachengesetze zu achten. Eine Verletzung stellt zum Beispiel ein Apostroph dar, den das traditionelle Kaufhaus Eaton’s überall im Land verwenden darf. Nur nicht in Québec. Hier heißt Eaton’s „Eaton“. Und die älteste Kaufhauskette Kanadas heißt von Küste zu Küste „The Hudson’s Bay Company„. Hier in Québec kurz: „La Baie„. Klingt nicht nach viel Geschichte. Nehmen wir also mal an, Sie sind Besitzer eines Optikerladens und nennen sich „New Look„. Nehmen wir weiterhin an, diese Bezeichnung hat sich im Laufe der Jahre bei Ihrer Kundschaft eingeprägt und Sie denken gar nicht daran, Ihr Firmenlogo zu verändern.

Erlaubt: Newlook mit "Lunetterie"
Eines Tages klopft ein gestrenger Herr vom „Büro zur Erhaltung der deutschen Sprache“ bei Ihnen an und verlangt, dass sie künftig auf Ihre Firmenbezeichnung verzichten. Sie lehnen ab. Er droht. Lenkt aber ein, als Sie gerade dabei sind, Ihren Anwalt anzurufen. Sie haben Glück: Der gestrenge Herr hat einen guten Tag und gibt sich milde. Er bietet Ihnen an, nicht ganz auf die Bezeichnung „New Look“ verzichten zu müssen. Aber er zwingt Sie per Gesetz, künftig das Wort „Augenoptiker“ davor zu setzen. Also heißt Ihre Firma jetzt „Augenoptiker New Look“. Etwas sperrig, was? Genau das passiert zurzeit in der Provinz, in der ich lebe. Die offizielle Amtssprache in Québec ist Französisch. 80 Prozent der Bevölkerung sind damit aufgewachsen. Aber die restlichen 20 Prozent – das sind immerhin knapp eineinhalb Millionen Einwohner – sprechen kein, oder nur sehr wenig Französisch. Und genau denen soll es jetzt verstärkt an den Kragen gehen. Oder vielmehr an die Sprache.

Farine statt Flour
Warum diese sonst so lässige Provinz Québec absolut humor-resistent wird, wenn es um ihre Landessprache geht, habe ich nie so richtig verstanden. Meine Québecker Freunde meinen, ich würde den Grund für die Obsession mit dem Französischen ohnehin nicht kapieren. „Das spielt sich bei uns in der Seele ab“, meinte Céline einmal. „Und die versteht ein anderer nicht.“ Nun gut. Ich glaube, es hat ein bißchen, aber nicht ausschließlich, mit Intoleranz zu tun. Schon eher mit Angst, man würde ihnen etwas wegnehmen. Die französische Sprache nämlich. Die wird auf dem amerikanischen Kontinent nur noch in Québec, in der Nachbarprovinz New Brunswick, ein bisschen in Louisiana und in einem Städtchen namens St. Boniface in Manitoba gesprochen. Je ein paar Frankokanadier leben noch in Alberta und Ontario. Das war’s dann schon. Irgendwo verständlich, dass Québec also fast militant seine Muttersprache verteidigt.

STOP ist verboten
Jährlich gehen bis zu 3000 Beschwerden bei der Sprachenpolizei ein. Da geht es dann um weltbewegende Dinge wie den Apostroph von „Eaton’s„. Oder auch um Verkehrsschilder. STOP geht gar nicht und wird bestraft. Korrekt ist – in Québec – ARRÊT. Übrigens liest man selbst in Paris, der Wiege des Franzöischen, STOP und nicht ARRÊT. – Die auf dem ganzen Kontinent bekannte Mehlfabrik „Five Roses“ hatte diesem schönen Namen bis vor ein paar Jahren noch das Wort „Flour“ (Mehl) vorgeschaltet. Bis die Sprachenpolizei kam. Jetzt wird in einem Kauderwelsch geworben: „Farine Five Roses„.
Manchen wird der Sprachenzirkus in Québec zu bunt: Sie packen zusammen
Aber nicht alle, lassen sich diesen Sprachen-Zirkus gefallen. Wie der Schweizer Konditor, der jahrelang seinen „Swiss Pastry Shop“ betrieben hatte. Bis die Polizei kam. Auf eine Namensänderung wollte sich der Besitzer nicht einlassen. Deshalb verkaufte er sein Geschäft. Ich vermute mal, der neue Besitzer ist Wiener. Der Laden heißt jetzt Patisserie Suisse Viennoise. So viel Süßes im Namen muss der Sprachenpolizei einfach gefallen.



 Ich liebe Französisch. Und ich wünschte, ich würde es genau so fließend sprechen und schreiben wie Englisch oder Deutsch. Aber ich habe lange in einem rein englischsprachigen Umfeld gelebt und bin aus der Übung gekommen. Jetzt klingt mein Französisch zwar noch nicht ganz wie Polnisch rückwärts. Aber an der Sorbonne vermutet man mich jetzt auch nicht gerade. Es gibt also, rein sprachlich gesehen, Steigerungsmöglichkeiten. Vor allem nach oben.
Ich liebe Französisch. Und ich wünschte, ich würde es genau so fließend sprechen und schreiben wie Englisch oder Deutsch. Aber ich habe lange in einem rein englischsprachigen Umfeld gelebt und bin aus der Übung gekommen. Jetzt klingt mein Französisch zwar noch nicht ganz wie Polnisch rückwärts. Aber an der Sorbonne vermutet man mich jetzt auch nicht gerade. Es gibt also, rein sprachlich gesehen, Steigerungsmöglichkeiten. Vor allem nach oben.





 Québec ist zwar – noch – keine eigene Nation. Aber ein Nationalgericht haben die Frankokandier schon mal auserkoren: Poutine. Wie Putin. Nur ohne Wladimir. Dafür mit Pommes, Käse und Schlabbersoße. Jeder kennt es hier. Angeblich soll es auch jeder lieben. Nur ich nicht. Ich hasse es. Seit gestern weiss ich, warum ich 30 Jahre gewartet habe, ehe ich mich zum Selbstversuch überwinden konnte.
Québec ist zwar – noch – keine eigene Nation. Aber ein Nationalgericht haben die Frankokandier schon mal auserkoren: Poutine. Wie Putin. Nur ohne Wladimir. Dafür mit Pommes, Käse und Schlabbersoße. Jeder kennt es hier. Angeblich soll es auch jeder lieben. Nur ich nicht. Ich hasse es. Seit gestern weiss ich, warum ich 30 Jahre gewartet habe, ehe ich mich zum Selbstversuch überwinden konnte.
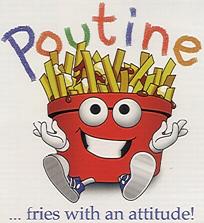 „Als ehemaliger Québecois auf Zeit ist mir nach anfänglichen Bedenken die Poutine doch sehr ans Herz gewachsen. Leider fehlte mir bisher zur Zubereitung dieser reichhaltigen Mahlzeit die richtige Käseart. Diesen Sommer hab ich nun endlich die temporäre Lösung entdeckt: Ein griechischer Grillkäse aus dem Edeka. Es schmeckt zwar nicht gleich, aber es schmeckt. Ça fait la job – wie der Québecois sagen würde.“ Und dann noch der Satz, der mir keine andere Wahl als den Selbstversuch ließ: „Thema Poutine ist bestimmt in absehbarer Zeit auch ein Thema für deinen Blog, oder?“ Klar doch, Julian. Schließlich lässt man die Verwandtschaft nicht im Stich.
„Als ehemaliger Québecois auf Zeit ist mir nach anfänglichen Bedenken die Poutine doch sehr ans Herz gewachsen. Leider fehlte mir bisher zur Zubereitung dieser reichhaltigen Mahlzeit die richtige Käseart. Diesen Sommer hab ich nun endlich die temporäre Lösung entdeckt: Ein griechischer Grillkäse aus dem Edeka. Es schmeckt zwar nicht gleich, aber es schmeckt. Ça fait la job – wie der Québecois sagen würde.“ Und dann noch der Satz, der mir keine andere Wahl als den Selbstversuch ließ: „Thema Poutine ist bestimmt in absehbarer Zeit auch ein Thema für deinen Blog, oder?“ Klar doch, Julian. Schließlich lässt man die Verwandtschaft nicht im Stich.
 Vor zwei Jahren wurde Poutine sogar zum Politikum. Zu einer „Canada Day„-Party in der kanadischen Botschaft in Washington hatten Witzbolde ein Poster mit Samuel de Champlain, einem der Entdecker Kanadas, aufgehängt. Im historischen Gewand trägt Monsieur de Champlain nicht sehr würdevoll ein Tablett mit dampfender Poutine vor sich her. Québecker Separatisten fürchteten um den guten Ruf ihrer Nationalspeise und verlangten eine offizielle Entschuldigung des kanadischen Premierministers. Sie steht noch aus.
Vor zwei Jahren wurde Poutine sogar zum Politikum. Zu einer „Canada Day„-Party in der kanadischen Botschaft in Washington hatten Witzbolde ein Poster mit Samuel de Champlain, einem der Entdecker Kanadas, aufgehängt. Im historischen Gewand trägt Monsieur de Champlain nicht sehr würdevoll ein Tablett mit dampfender Poutine vor sich her. Québecker Separatisten fürchteten um den guten Ruf ihrer Nationalspeise und verlangten eine offizielle Entschuldigung des kanadischen Premierministers. Sie steht noch aus.